
Die besten 10 im November 2025
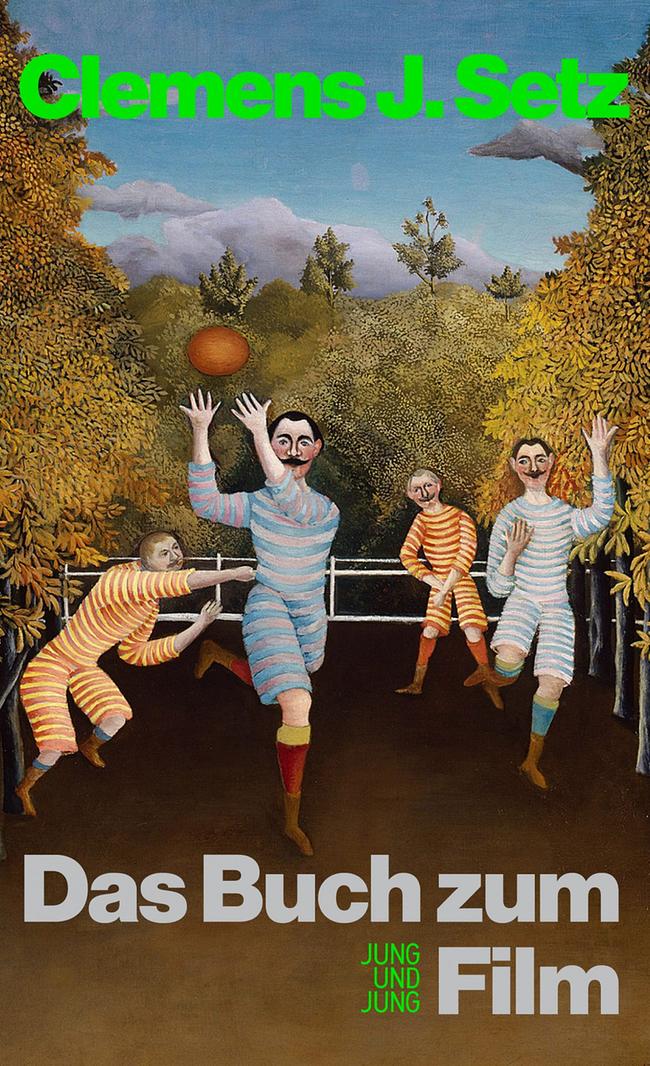
1. Clemens J. Setz (25 Punkte) NEU
„Das Buch zum Film“, Jung und Jung
Clemens J. Setz zählt zu den jüngsten Büchner-Preisträgern in der Geschichte dieser größten Auszeichnung, die einem deutschsprachigen Autor zuteilwerden kann. Mit Romanen wie "Monde vor der Landung'„ oder “Die Stunde zwischen Frau und Gitarre„ hat er sich ein großes Publikum “erschrieben„. Jetzt ist ein neues Buch von ihm erschienen: Der Titel: “Das Buch zum Film". Es gewährt Einblicke in das Werden eines Schriftstellers, mittels einer Sammlung von Tagebuchaufzeichnungen aus den Jahren 2000 bis 2010, die der heute 42jährige für das Buch neu geordnet hat. Erfahrenes, Gesehenes, Gelesenes findet darin fragmentarisch Platz: wir begegnen einem jungen Schriftsteller, der früh schon der Literatur verfallen war und sich dieser geradezu rücksichtslos verschrieben hat. Clemens Setz erzählt im „Buch zum Film“ auch von seinen Eltern, der ersten großen Liebe, der Teilnahme an den Tagen der deutschsprachigen Literatur, der Sehnsucht danach, selbst Kinder zu haben und von vielem anderen mehr: Das Autobiographische darin gibt allerdings das große Rätsel Leben nicht preis.
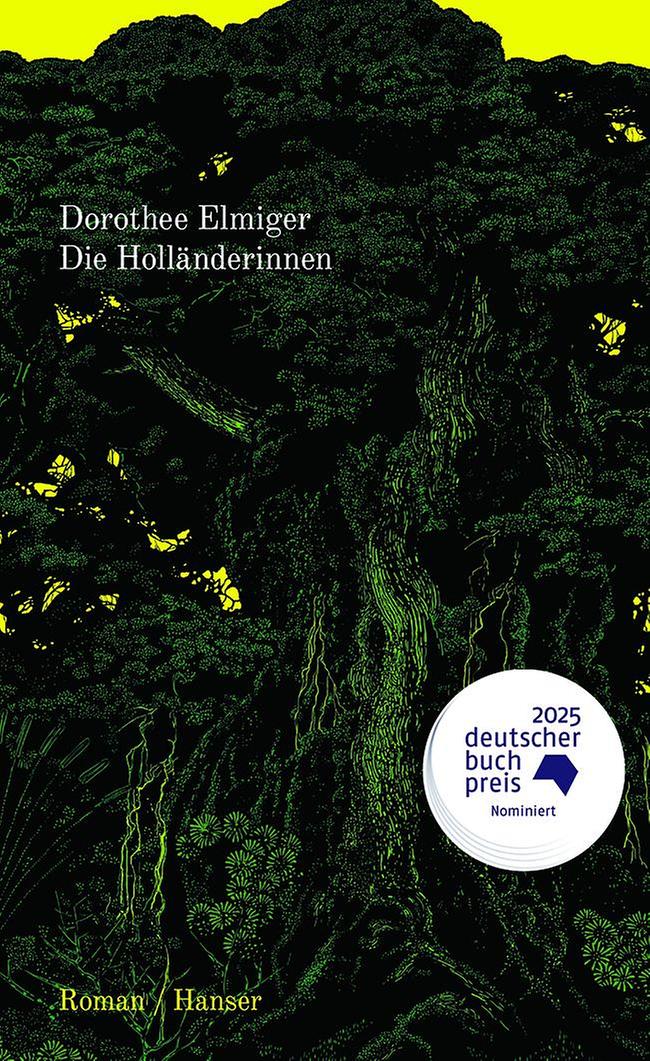
2. Dorothee Elmiger (24 Punkte)
„Die Holländerinnen“, Hanser
Seit ihrer Teilnahme beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb im Jahr 2010 zählt die 1985 geborene Dorothee Elmiger zu den spannendsten Stimmen der jüngeren Schweizer Literatur. Vier Romane hat Elmiger bislang vorgelegt, 2020 wurde „Aus der Zuckerfabrik“ auf die Shortlist des Deutschen als auch des Schweizer Buchpreises gesetzt, auch ihr neuer Roman „Die Holländerinnen“ befindet sich auf den Shortlists beider Buchpreise und wurde von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bereits jetzt zum „besten Roman des Bücherherbsts“ gekürt. Im Zentrum des Romans steht das Verschwinden zweier Holländerinnen im lateinamerikanischen Dschungel. Dem rätselhaften Schicksal der beiden Frauen möchte ein Theaterregisseur nachspüren und begibt sich mit einem mehrköpfigen Team hinein in den dunklen Urwald. Mit dabei: die Erzählerin der Geschichte, eine namhafte Schriftstellerin, die die ganze Expedition dokumentieren soll. Der Regisseur treibt die Crew trotz Widerstände immer tiefer und tiefer in den Wald, sein Vorhaben entpuppt sich dabei als weniger von Empathie, sondern von Größenwahn getrieben, denn er scheint mit dem Projekt in Wahrheit in die Fußstapfen von Künstlern wie Werner Herzog und Francis Ford Coppola treten zu wollen. Mittels einer fragmentarischen und ebenso komplexen wie faszinierenden Erzählstruktur lotet Dorothee Elmiger in „Die Holländerinnen“ die Abgründe der menschlichen Existenz aus.
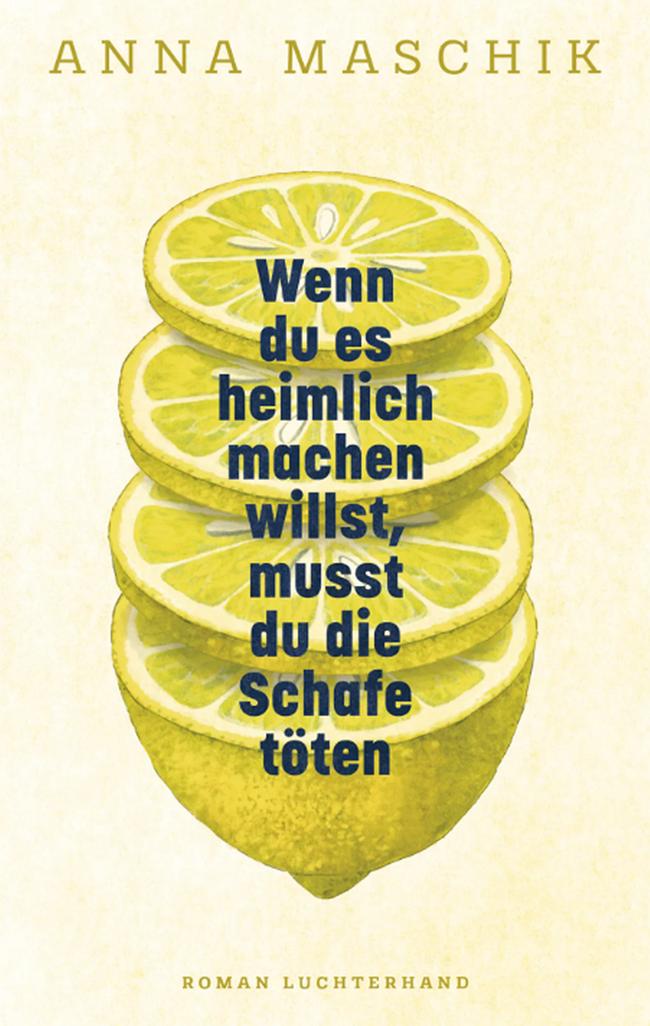
3. Anna Maschik (22 Punkte)
„Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten“, Luchterhand
Selten gelingt jungen Autorinnen und Autoren mit dem ersten Roman gleich ein erfolgsversprechendes Debüt. Die junge Wiener Lehrerin Anna Maschik aber hat mit ihrem Erstling eine ebenso inhaltlich wie formal beeindruckende Familiengeschichte vorgelegt, mit dem geheimnisvollen, scheinbar mordlustigen Titel: „Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten“. Anna Maschiks Roman ist jedoch nicht blutrünstig, sondern poetisch und hart: sie seziert eine Familie über vier Generationen, ausgehend von einem Bauernhof in der Nazi-Zeit: der Titel „Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten“ ist auch der erste Satz. Er bezieht sich auf die Praxis des „Schwarzschlachtens“, also behördlich nicht erlaubtes Schlachten von Nutztieren, bei dem bevorzugt die anscheinend geräuschlos und damit unauffällig sterbenden Schafe getötet wurden. Es geht um wortkarge Menschen, die alles anders machen wollen als ihre Vorfahren und deren Lebenswege doch vorgezeichnet sind: um verletzte Verwandte, die sich in Möbel und Pflanzen verwandeln. Ein Roman voller Magie - und voller Auslassungen, denn Maschik setzt stilistisch bewusst auf das Fragmentarische und Lückenhafte.
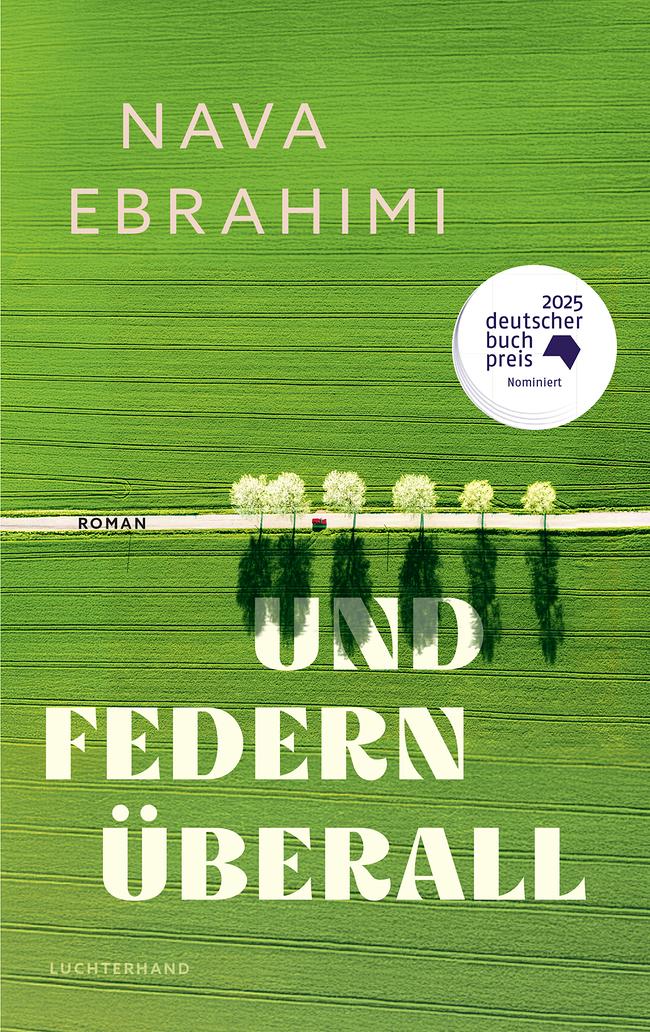
4. Nava Ebrahimi (21 Punkte)
„Und Federn überall“, Luchterhand
Spätestens seit der Auszeichnung mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis im Jahr 2021 gilt die in Graz lebende Schriftstellerin Nava Ebrahimi als Fixstern der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Nun liegt der dritte Roman der iranisch-deutschen Autorin vor, mit dem sie auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist: „Und Federn überall“ kreist um die Frage: Wie bleiben wir menschlich, wenn das Leben immer härter wird? Dreh- und Angelpunkt des Romans ist allerdings ein Tier, und zwar das Huhn. Nava Ebrahimi schildert das Leben von Menschen in einer Kleinstadt, deren wichtigster Arbeitgeber ein Schlachtbetrieb ist. Dass die Hühnerbrust durch eine Krankheit verhärtet, sie wertlos macht, ist hier Problem und Metapher. Jeder muss Federn lassen, für sein kleines Glück kämpfen in diesem Gesellschaftsroman: Die alleinerziehende Fließbandarbeiterin. Der Manager mit weichem Kern. Der blinde Dichter aus Afghanistan. Ebrahimi erzählt einen Tag aus deren unterschiedlichen Perspektiven. Ein Roman voll feiner Ironie, geschrieben mit klarem, humanem Blick.
Mehr auf fm4.orf.at
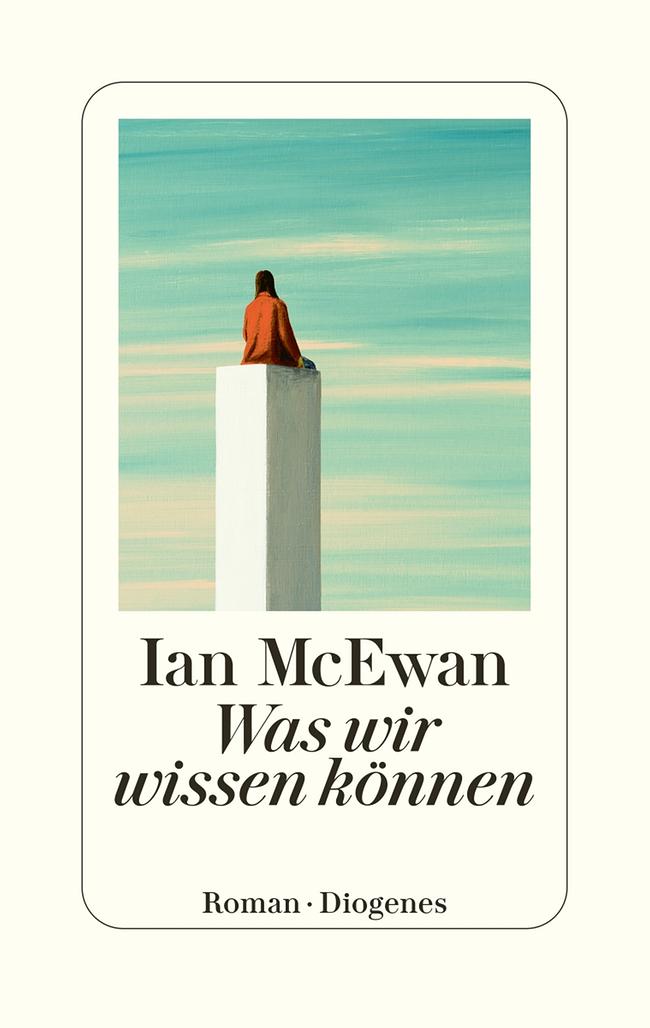
5. Ian McEwan (19 Punkte) NEU
„Was wir wissen können“, Diogenes
Millionenfach hat er seine Romane verkauft, Bestseller wie ‚Abbitte‘ wurden verfilmt – und längst ist er selbst Teil der Literaturgeschichte: Ian McEwan. Nun hat der britische Booker-Preisträger Ian McEwan einen neuen großen Roman vorgelegt. Er trägt den Titel „Was wir wissen können“ und wirft einen ebenso unterhaltsamen wie kritischen Blick auf unsere Gegenwart, und zwar rückblickend – aus der Zukunft. Ian McEwan, der oft der „Sir der britischen Gegenwartsliteratur“ genannt wird, beweist mit diesem Roman abermals, dass er ganz genau weiß, was guten Lesestoff ausmacht: eine geheime Liebe, ein Verbrechen, und große Fragen der Menschheit. „Was wir wissen können“ spielt im 22. Jahrhundert, lange nach Klima- und Atomkatastrophe. Ein Literaturwissenschafter macht sich in der Zukunft auf die Suche nach einem geheimnisvollen Liebesgedicht aus dem Jahr 2014: und beleuchtet so die - aus seiner Sicht - gute, alte Zeit. Und so beschreibt Ian McEwan in diesem hoffnungsvollen Roman wie schön, wie erhaltenswert unsere Zeit ist - allem zum Trotz.
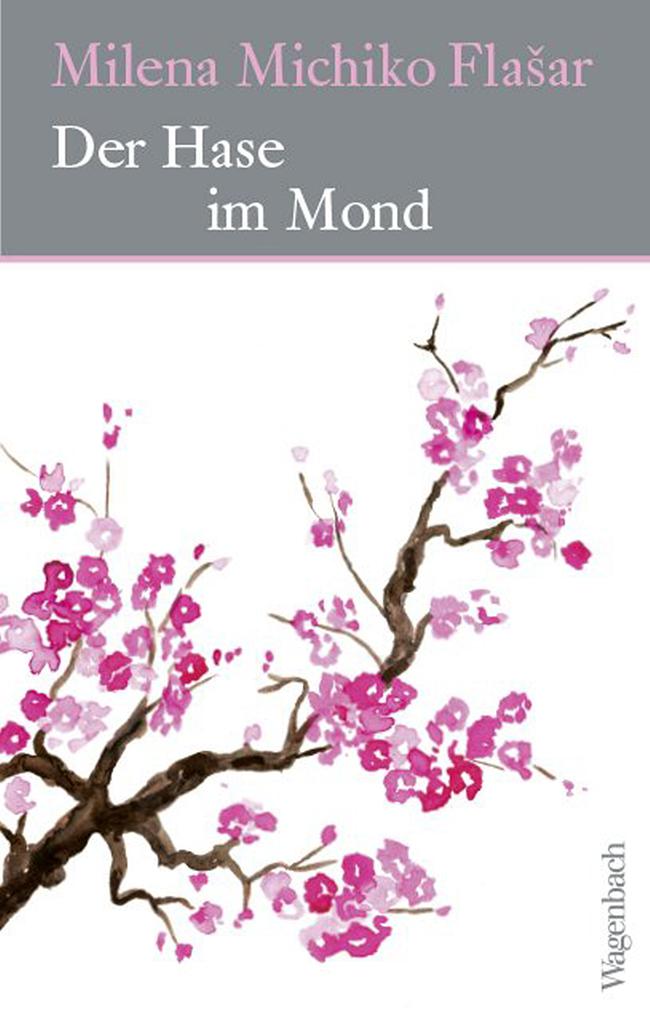
6. Milena Michiko Flašar (17 Punkte)
„Der Hase im Mond“, Wagenbach
Die Autorin Milena Michiko Flašar ist als Kind zweier Kulturen aufgewachsen: Mit einer japanischen Mutter und einem österreichischen Vater verbrachte sie ihre Schulzeit in Niederösterreich, später studierte sie in Wien und Berlin. Wie stark die Sprache und Kultur Japans ihre Literatur prägen, zeigt auch ihr jüngstes Buch „Der Hase im Mond“, eine Sammlung von Kurzgeschichten. Darin entfaltet Flašar zarte, leise und zugleich scharf beobachtete Miniaturen über Einsamkeit, Nähe und das flüchtige Glück. Immer wieder verwebt sie europäische Erzähltradition mit Elementen der japanischen Literatur: poetische Verdichtung, das Spiel mit Andeutungen und eine fantastische Erzählweise, in der Alltägliches plötzlich ins Traumhafte kippt. So entstehen Geschichten, die scheinbar unscheinbare Momente in den Mittelpunkt rücken – und ihnen eine stille, fast magische Größe verleihen.
Mehr dazu in Archive des Schreibens und auf fm4.orf.at
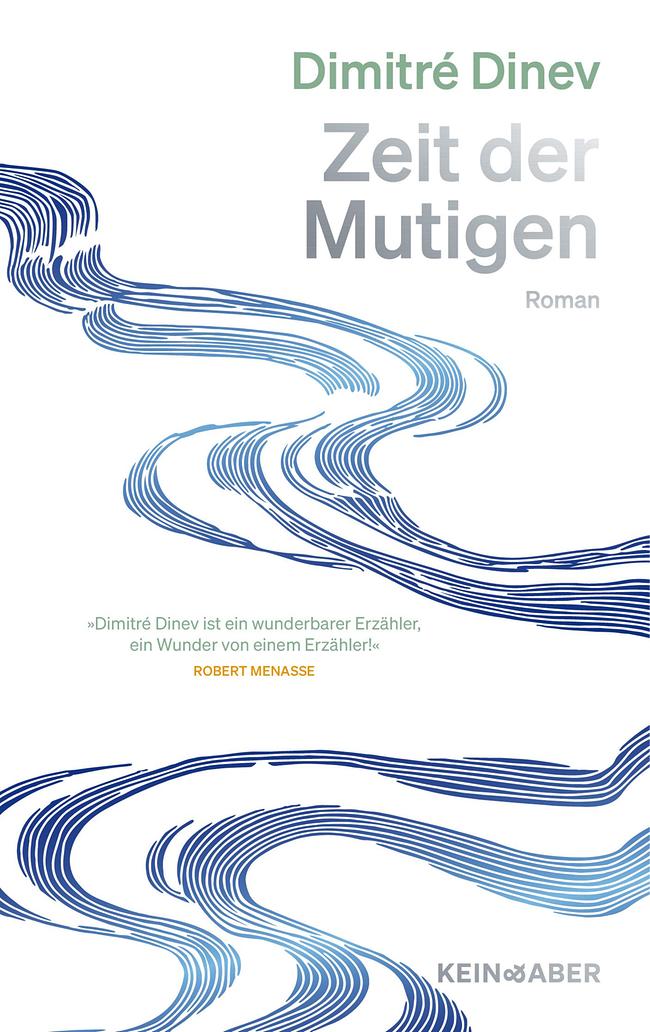
7. Dimitré Dinev (14 Punkte)
„Zeit der Mutigen“, Kein & Aber
Als illegaler Flüchtling kam Dimitré Dinev 1990 nach Österreich, hielt sich als Student mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser, bis er, mit seinem Erstlingsroman „Engelszungen“ einen Bestseller landete. Seither ist der Autor aus der heimischen Gegenwartsliteratur nicht mehr wegzudenken. An seinem jüngsten Buch hat Dinev 13 Jahre gearbeitet: Auf mehr als 1000 Seiten erzählt „Zeit der Mutigen“ von individuellen Schicksalen im Schatten der europäischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Beginnend am Vorabend des 1. Weltkriegs, über die Wirtschaftskrise der 1920er-Jahre, den Aufstieg der Nationalsozialisten, den 2. Weltkrieg, dem kommunistischen Totalitarismus Osteuropas und seinem Nachwirken bis in die 1990er-Jahre. Was die Erzählfäden miteinander verbindet, ist die Donau, an deren Ufern die Romanhandlung über weite Strecken verortet ist. Seine Protagonisten sind Einzelgänger und Außenseiter, eigensinnig und widerspenstig und eben mutig, sei es gegenüber den autoritären Machthabern oder der Mehrheitsgesellschaft in den totalitären Regimen, in den Lagern oder im Krieg. Im Roman heißt es einmal: „Die stärkste Kraft, die wir besitzen, ist die Vorstellungskraft“. Dimitré Dinev ist in jedem Fall einer ihrer talentiertesten Beschwörer.
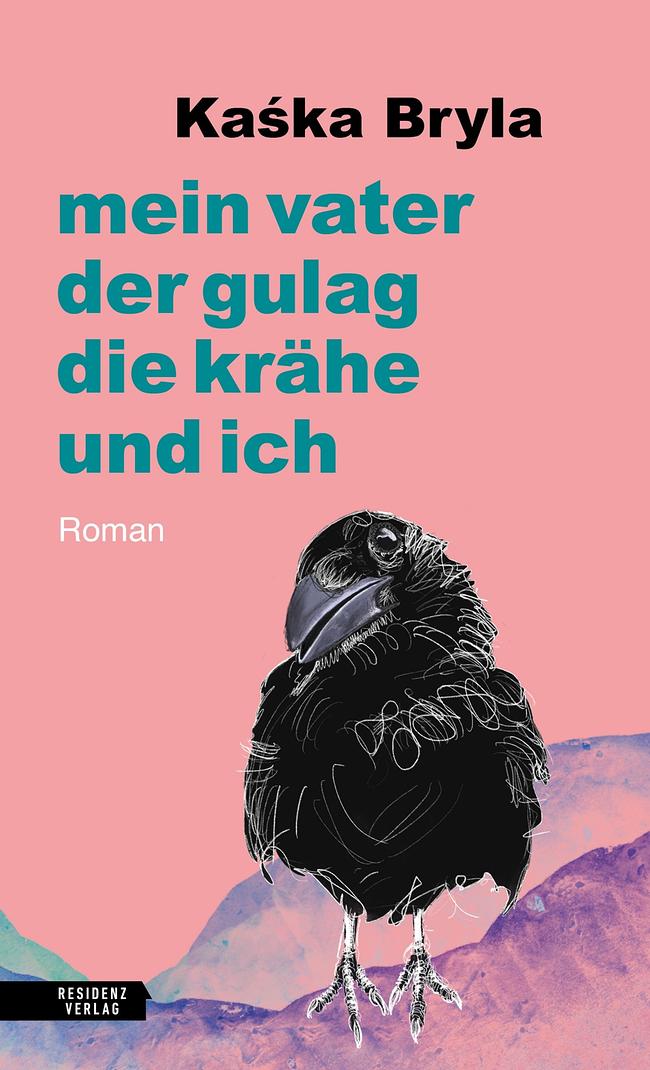
8. Kaśka Bryla (12 Punkte)
„Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich“, Residenz
Die Schriftstellerin Kaśka Bryla konnte schon mit ihrem Debütroman „Roter Affe“ große Erfolge feiern. Nun hat die Wienerin mit polnischen Wurzeln ihr mittlerweile drittes Buch „Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich“ vorgelegt Aus dem Manuskript hat Bryla bereits im vergangenen Jahr beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt vorgelesen, wo sie auf Einladung von Brigitte Schwens-Harrant teilgenommen hatte. Der Roman ist eine autofiktionale Hommage an ihren Vater, der im Zweiten Weltkrieg im polnischen Widerstand kämpfte. Vor seinem Tod im Jahr 2009 hat er seiner Tochter das Versprechen abgenommen, dass sie eines Tages seine Geschichte aufschreiben wird. Stunden über Stunden an Gesprächsaufzeichnungen, dicke Ordner an Recherchematerial, eine umfangreiche Literaturliste zu dem Thema: trotz intensiver Recherchearbeit hatte Bryla das Romanprojekt lange in der Schublade liegen lassen, bis zum Sommer 2020. Konfrontiert mit einer schweren Coronaerkrankung und einer schier endlos langen Quarantäne, die sie allein mit einer verletzten Krähe verbrachte, fand Bryla schließlich einen Zugang zu ihrem Romanstoff. In langen, atemlosen Sätzen erzählt sie nicht nur vom Vater, der sich noch als Teenager der der sogenannten „Armija Krajova “ angeschlossen hatte, nachdem Polen von Nazi-Deutschland und der Sowjet-Union gleichzeitig angegriffen wurde. Sie schreibt auch über diesen seltsamen ersten Corona-Sommer, der unsere Gesellschaft auf eine bis dahin unvorstellbare Weise erschüttert hat, auch wenn kaum jemand mehr davon spricht. Ohne Unvergleichbares zu vergleichen, hat Bryla mit „Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich“ einen berührenden Dialog zwischen Vater und Tochter geschrieben: über menschlichen Zusammenhalt und das Leben im Ausnahmezustand.
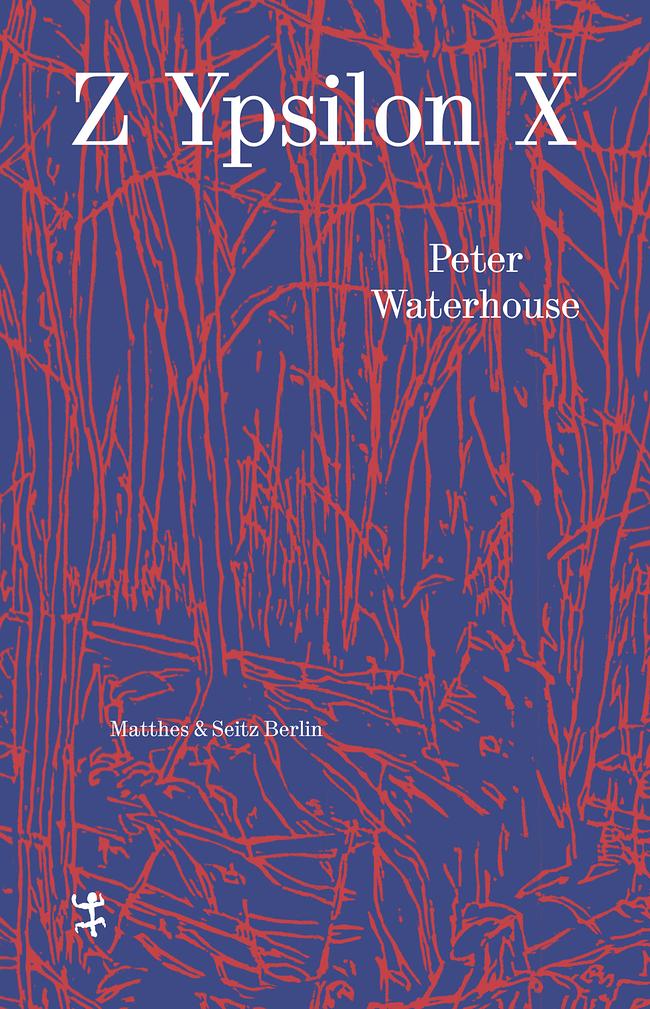
9. ex aequo: Peter Waterhouse (11 Punkte)
„Z Ypsilon X“, Matthes & Seitz
Das Sich-Bewegen zwischen den Sprachen, das Über-Setzen: es prägt das Leben wie Werk von Peter Waterhouse. Er selbst ist zweisprachig aufgewachsen: mit Deutsch und Englisch. Die zweisprachige Südkärntner Gegend ist einer seiner Lebensmittelpunkte. Seine Eltern haben hier vor Jahrzehnten ein Haus erworben, der Vater war hier als britischer Offizier stationiert. Dieser historisch verwundete wie kulturell reiche Landstrich: er gibt dem jüngsten Werk von Peter Waterhouse einen Rahmen, thematisch wie formal. Ausgangspunkt von „Z Ypsilon X“ ist eine Erbschaft: Bücher der Großeltern mütterlicherseits. Von Shakespeare, Goethe, Dostojewski, Dickens, Hölderlin bis hin zu Kraus, Altenberg und vielen anderen mehr: all das haben sie gelesen. Das hat sie nicht davon abgehalten, dem Nationalsozialismus zu huldigen: der eigene Großvater wurde zu einem wichtigen Rädchen in der NS-Propagandamaschinerie. Peter Waterhouse sagt: „Sie haben alles gelesen und konnten doch nicht lesen.“ Dieses Rätsel ist die Wunde, um die dieser Text kreist. Waterhouse liest die Bücher der Großeltern wieder, auf der Suche nach Zeichen darin, nach Vermerken. Mit „Z Ypsilon X“ liegt ein Monolith der Gegenwartsliteratur vor, in dem Stille und Langsamkeit in ihrer politischen Dimension sichtbar werden.
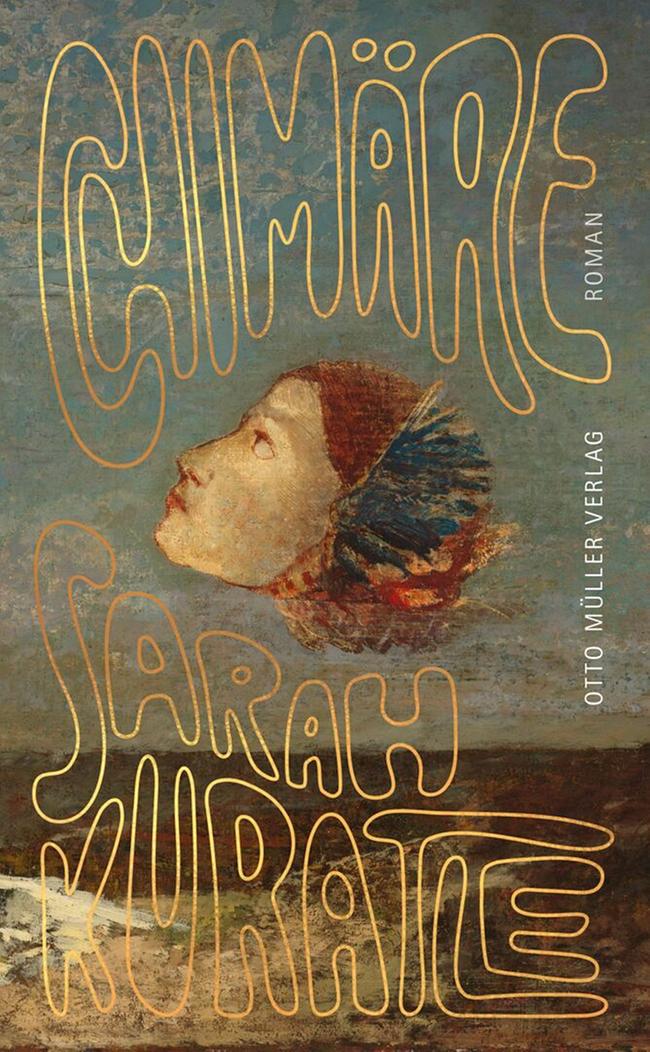
9. ex aequo: Sarah Kuratle (11 Punkte)
„Chimäre“, Otto Müller
Durch die Zerstörung der Natur und extreme Wetterereignisse wie Waldbrände oder steigende Meeresspiegel verlieren viele Menschen ihren Lebensraum. Davon handelt der neue Roman von Sarah Kuratle - mit dem Titel „Chimäre“. Es ist der zweite Roman der in Vorarlberg geborenen Autorin. Sie hat bereits mehrere literarische Auszeichnungen erhalten. Sarah Kuratles neuer Roman handelt von einer Forschungsstation in der Natur: Dort kämpfen Wissenschaftler verzweifelt gegen das Artensterben. Doch deren Pflanzenstudien bringen sie nicht weiter. Zunehmend zerbrechen die Teammitglieder an ihrem Vorhaben. Kuratle erzählt von vertriebenen Menschen, die wegen zunehmender Naturzerstörung ihren Heimatraum verlieren. Ein dystopisches Setting, das gleichzeitig erschreckend nahe an der Jetztzeit ist. Märchenhaft und mit sprachlicher Nähe zur Lyrik zeigt „Chimäre“, wie untrennbar der Mensch mit der Natur verbunden ist.