
Die besten 10 im Mai 2025
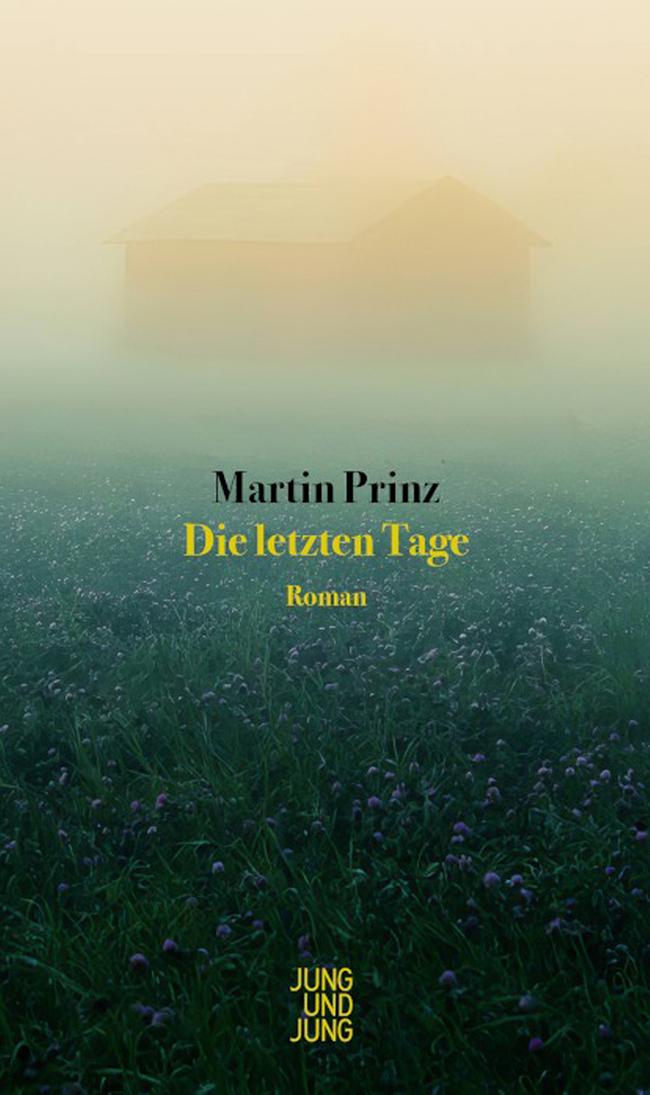
1. Martin Prinz (27 Punkte)
„Die letzten Tage“, Jung und Jung
Heuer jährt sich das Ende des 2. Weltkriegs zum 80. Mal. Die letzten Wochen des sogenannten Dritten Reichs waren bekanntlich von Chaos und Gewaltexzessen geprägt. Mit einem dieser sogenannten „Endphaseverbrechen“ hat sich der österreichische Autor Martin Prinz in seinem neuen Roman „Die letzten Tage“ beschäftigt. Die Hauptrolle spielt dabei ein Aktenberg aus dem Wiener Stadt und Landesarchiv: Akribisch ist darin der Prozess gegen Johann Braun, den NSDAP-Kreisleiter Neunkirchen, dokumentiert. Im April 1945 errichtete dieser in der Region Rax/Schneeberg ein Standgericht, als dessen selbsternannter Richter er insgesamt 29 Menschen exekutieren ließ. Willkürlich entschied der gelernte Bäcker-Gehilfe mit seinen Schergen über Leben und Tod, machte Jagd auf Fahnenflüchtige und sonstige politisch unliebsame Personen – und dass, während die russische Armee stündlich vorrückte und sich der Untergang des deutschen Reichs überdeutlich abzeichnete. Bewusst hat Prinz die Geschichte nah an den historischen Gerichtsakten erzählt, um so die Sprache, mit der die Täter ihr Vorgehen rechtfertigen, vorzuführen. Der Roman zeigt eindrücklich, wie sich diese in Passivkonstruktionen und Konjunktiven versuchen aus der Verantwortung zu ziehen und bis zuletzt überzeugt davon sind, bloß ihre Pflicht getan zu haben.
Mehr dazu auf sound.orf.at
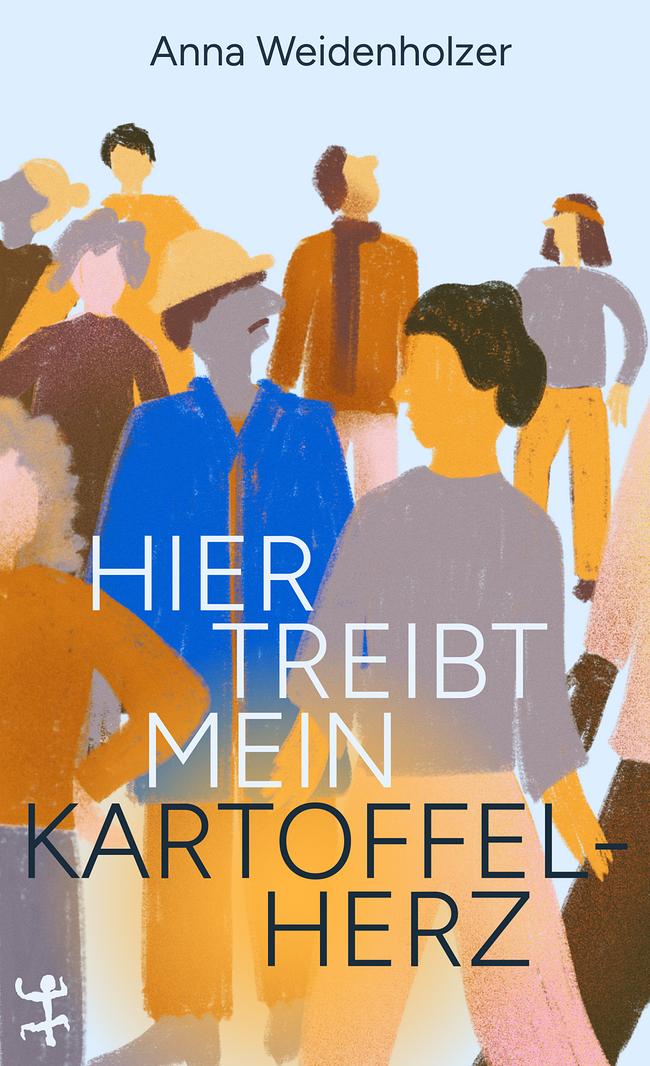
2. Anna Weidenholzer (24 Punkte)
„Hier treibt mein Kartoffelherz“, Matthes & Seitz Berlin
Nach der Veröffentlichung ihres Debüts „Der Platz des Hundes“ im Jahr 2010 wurde die 1984 in Linz geborene Anna Weidenholzer zu einer der großen Nachwuchshoffnungen der österreichischen Literaturszene erklärt. In kurzen Abständen folgten gleich drei Romane, die vom deutschsprachigen Feuilleton umjubelt und mit Nominierungen für die großen deutschen Buchpreise belohnt wurden. Nach einer mehr als 6-jährigen Pause macht Weidenholzer mit einem neuen Erzählband auf sich aufmerksam, er trägt den Titel „Hier treibt mein Kartoffelherz“. Der Band ist eine Ode an die kurze Form: Gegliedert in 4 den Jahreszeiten nachempfundene Kapitel wechseln sich längere Erzählungen mit nur wenigen Sätzen umfassenden Skizzen ab, mal werden Geschichten erzählt, mal Beobachtungen festgehalten. Weidenholzers Figuren sind zartbesaitete Wesen mit rissigen Nervenkostümen, die jede Kleinigkeit aus der Bahn zu werfen droht. Da gibt es den spätherbstlichen Feriengast, der dann kommt, wenn alle weg sind, und auf Veränderungen geradezu allergisch reagiert. Oder die Umweltaktivistin, die sich so manisch für die Baumfürsorge einsetzt, dass man sich zu fragen beginnt, wer hier eigentlich Schutz braucht. Die hochverdichteten Texte lassen sich eigenständig lesen und sind doch lose miteinander verbunden, ähnlich einem literarischen Wimmelbild, wo jede Szene in einem größeren Ganzen aufgeht.
Mehr dazu auf oe1.orf.at
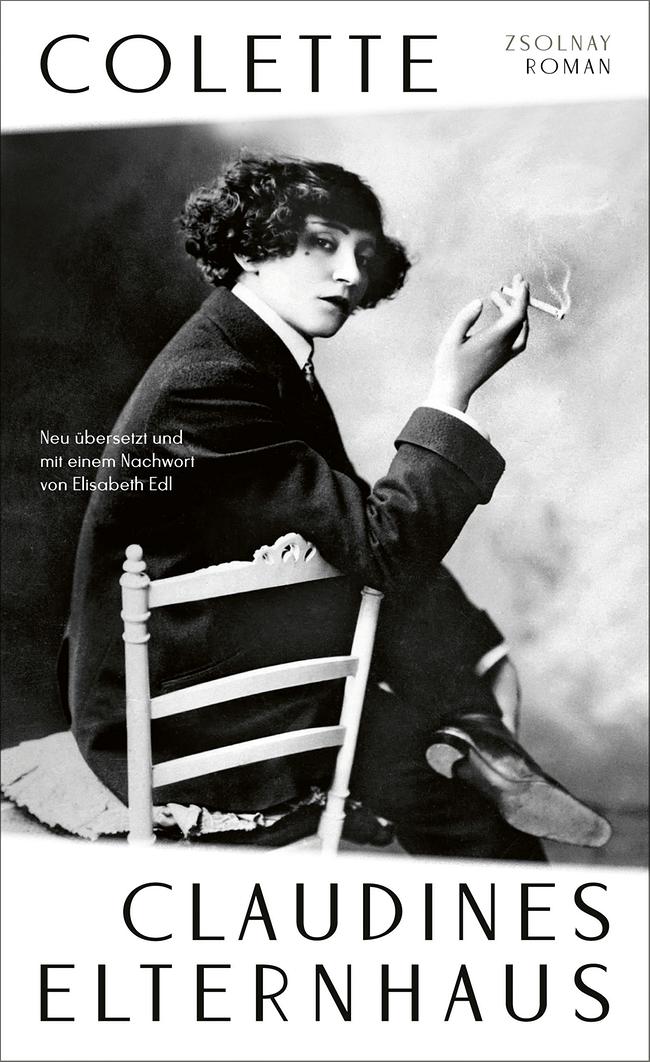
3. Colette (19 Punkte) NEU
„Claudines Elternhaus“, Zsolnay
Übersetzung: Elisabeth Edl
Sidonie Gabriel Claudine Colette - kurz „Colette“ genannt - ist eine der schillerndsten Figuren der französischen Literaturgeschichte. 1873 in Burgund geboren, heiratete sie mit 19 Jahren den wesentlich älteren Schriftsteller Monsieur Willy. Unter dessen Namen begann Colette die legendären Claudine-Romane zu schreiben, Bücher über ein junges Mädchen aus der französischen Provinz, die zu einem gigantischen Erfolg wurden. Nach der Scheidung von Willy folgte eine Karriere als Varieté-Tänzerin und ab Ende der 1910er Jahre schließlich der Durchbruch als Schriftstellerin, als die sie von Zeitgenossen wie Marcel Proust oder André Gide aufs höchste bewundert wurde. In diese Zeit fällt auch die Veröffentlichung des Buchs „Claudines Elternhaus“, das nun in neuer Übersetzung vorliegt. Colette erzählt darin ihre eigene Geschichte: Alles dreht sich um das Aufwachsen im ländlichen Burgund, eine Umgebung, in die ihre Familie durch die Belesenheit der Eltern und ihre ungewöhnlich selbstständige Mutter nicht recht hineinzupassen scheinen. Ein Roman, der auch mehr als 100 Jahre später keinerlei Staub angesetzt hat.
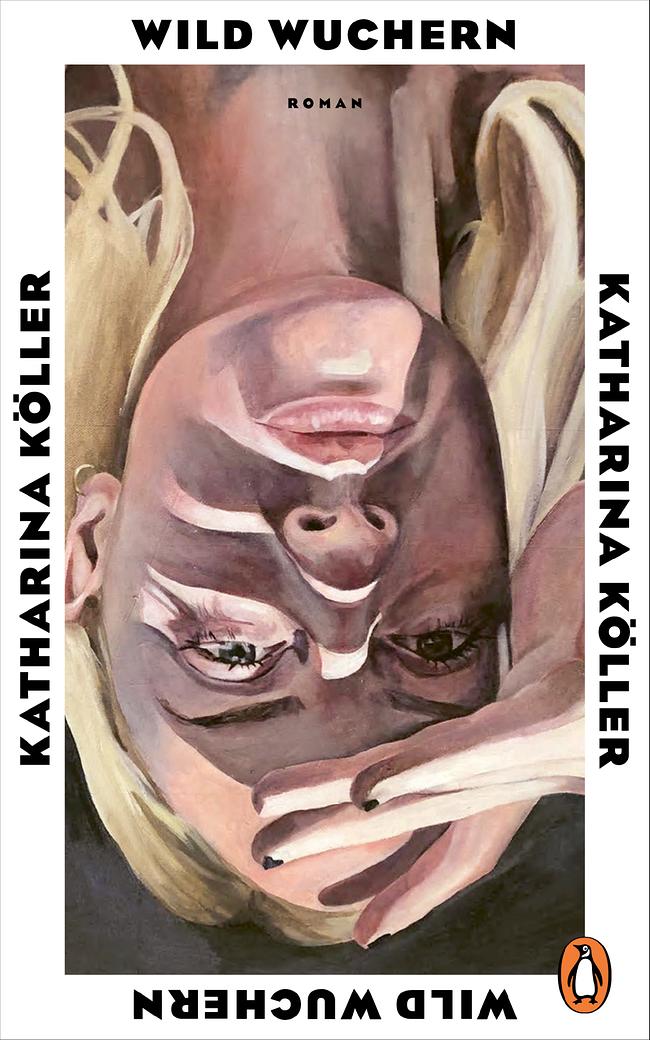
4. Katharina Köller (18 Punkte)
„Wild wuchern“, Penguin
Die 1984 in Eisenstadt geborene Katharina Köller hat sich vor allem mit Theaterarbeiten einen Namen gemacht, ihre Stücke wurden an zahlreichen österreichischen Bühnen gespielt. 2021 legte sie ihren vielgelobten Debütroman „Was ich im Wasser sah“ vor, eine gewitzte Fantasy-Parabel auf die Zerstörung der Ozeane. Nun folgt „Wild wuchern“. Die Handlung setzt mit der panischen Flucht der Hauptfigur Marie ein, die sich von ihrem Ehemann verfolgt fühlt. Mit dem Zug ist sie aus Wien Richtung Tirol gefahren, und rennt nun einen dichten Gebirgswald hinauf, das Ziel: eine einsame Berghütte, in die sich ihre Cousine Johanna vor Jahren zurückgezogen hat. Diese wiederum ist alles andere als begeistert davon, dass Marie plötzlich vor ihrer Tür steht. Die Eremitin scheint zwischenmenschlichen Kontakt vollends verlernt zu haben und möchte ihre Ruhe, doch Marie lässt nicht locker. Köller lässt zwei Welten aneinander prallen: Auf der einen Seite die urbane, stylishe Vorzeigefrau, Typ „Everybody’s Darling“. Auf der anderen Seite die zähe Selbstversorgerin, die niemanden an sich ranlässt. Die einzige Gemeinsamkeit: beide haben Geheimnisse, die mit jedem Konflikt stärker an die Oberfläche drängen.
Mehr dazu auf FM4.orf.at
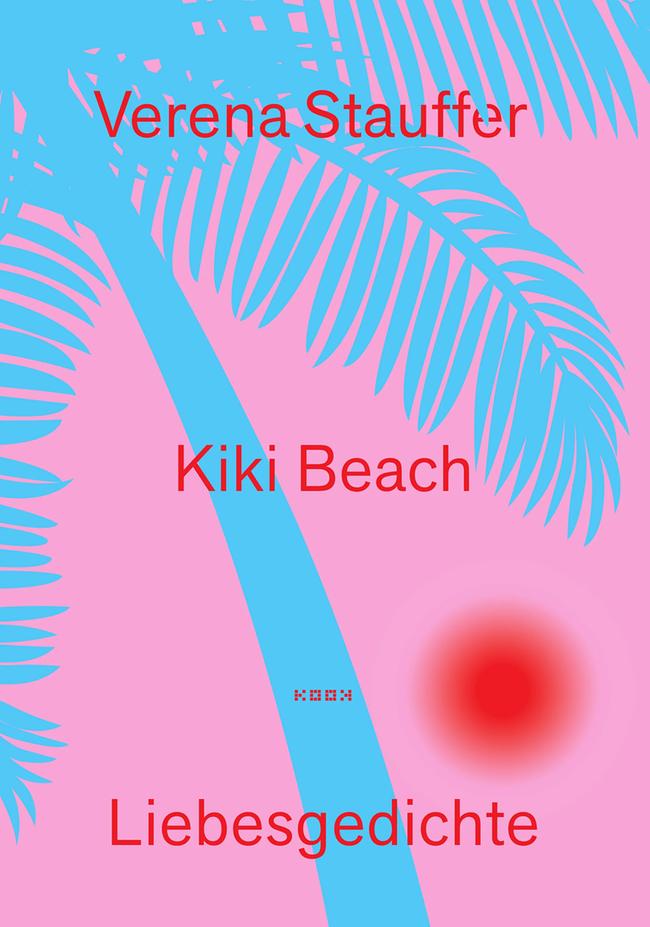
5. Verena Stauffer (17 Punkte)
„Kiki Beach“, kookbooks
Im deutschsprachigen Literaturbetrieb ist die zeitgenössische Lyrik zu einem absoluten Nischenprodukt geworden. Nur wenigen Autoren und Autorinnen gelingt es heutzutage mit Lyrikbänden größere Resonanz zu erzeugen, eine von ihnen: die 1978 in Oberösterreich geborene Schriftstellerin Verena Stauffer. Bereits ihr Band „Ousia“ hat 2020 für Aufsehen gesorgt, nicht zuletzt durch die Nominierung für den Österreichischen Buchpreis. Nun legt sie ihren neuen Gedichtband „Kiki Beach“ vor. Stauffer widmet sich darin einem Genre, dass in den vergangenen Jahrzehnten völlig aus der Mode gekommen ist, weil es oft als „Frauenliteratur“ abgestempelt wurde: die Liebeslyrik. Behutsam wird in „Kiki Beach“ das Genre ins Jetzt und Heute navigiert, ohne jemals den gigantischen historischen Referenzraum zu vergessen, aus dem es sich speist. Lustvoll spielt Stauffer mit dem modernen Dating-Jargon: Da wird auf „Situationships“ gesegelt, da wird gebannt auf die verheißungsvollen „Screens“ gestarrt, auf denen sich Liebesbeziehungen durch die Popularität von Online-Dating abspielen. Aber auch Aphrodite lässt grüßen, oder der Phallus des Uranos, wenn auch in Gestalt eines Dildos namens „Randy Rabbit“. Weniger als um die eine große Liebe geht es in Stauffers Gedichten um die Magie, die hinter jedem Kennenlernen steckt. Jenseits der Euphorie und den Schmetterlingen im Bauch werden zwischenmenschliche Beziehungen auch zu einem Schutzschild gegen das Chaos des Weltgeschehens.
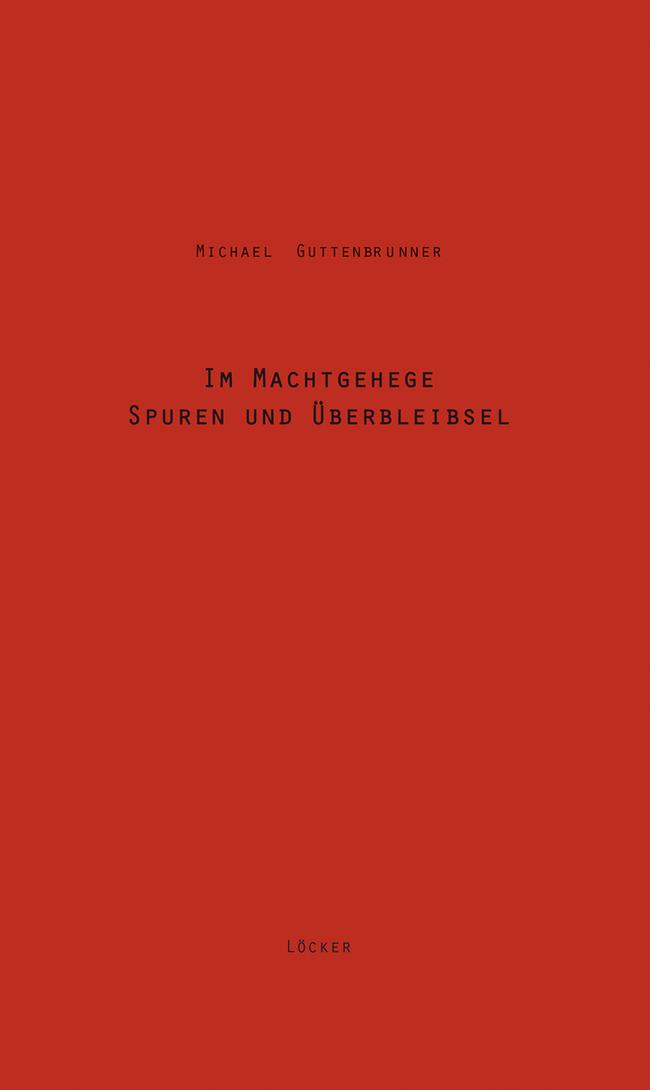
6. ex aequo: Michael Guttenbrunner (14 Punkte) NEU
„Im Machtgehege“, Löcker
Michael Guttenbrunner, Jahrgang 1919 galt in der österreichischen Literaturszene zeitlebens als unbequemer Außenseiter. Prägend für sein Leben und Schreiben war die Erfahrung des zweiten Weltkriegs: schon als Jugendlicher begehrte er gegen den Faschismus auf und wurde nach dem Einmarsch der Nazis der Schule verwiesen, weil er sich weigerte das Horst-Wessel-Lied zu singen. 1941 wurde Guttenbrunner zur Wehrmacht eingezogen, wo er drei Mal vors Militärgericht gestellt wurde. Nach dem Krieg zählte er zu jenen, die sich vehement gegen das Vergessen der nationalsozialistischen Verbrechen wehrte, allen voran in seiner Literatur. Als Opus Magnus gilt sein mehrbändiges Prosawerk „Im Machtgehege“, das, zwischen 1974 und 2008 erschienen, nun erstmals in einer vollständigen Ausgabe erscheint. In unzähligen, teils nur eine halbe Seite umfassenden Prosaminiaturen verarbeitet Guttenbrunner autobiografische Erinnerungen, politische Reflexionen und literarische Beobachtungen, die sich aus heutiger Sicht als eine der beeindruckendsten zeitgeschichtlichen Chroniken der österreichischen Literaturgeschichte lesen. Das titelgebende „Machtgehege“ verweist auf die metaphorische Umzäunung, in der der Mensch durch politische, religiöse und ideologische Zwänge gefangen ist. An diesem „Machgehege“ arbeitet sich Guttenbrunner mit großer literarische Sorgfalt und äußerster sprachlicher Präzision ab – und beweist, dass er seinem großen Vorbild Karl Kraus durchaus das Wasser reichen kann.
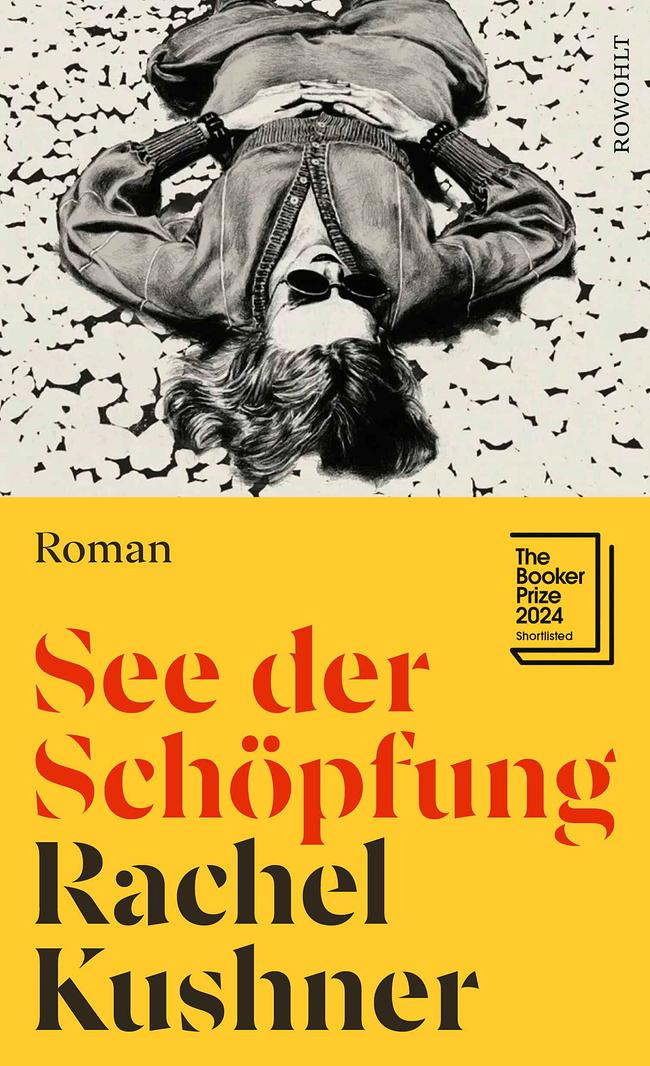
6. ex aequo: Rachel Kushner (14 Punkte) NEU
„See der Schöpfung“, Rowohlt
Übersetzung: Bettina Abarbanell
In der englischsprachigen Literatur zählt die Amerikanerin Rachel Kushner zu den Stars der Szene. Ihre Romane landen verlässlich auf den Shortlists der wichtigsten Literaturpreise, so auch ihre jüngstes Buch „See der Schöpfung“, das 2024 für den Booker Price nominiert war. Das Buch ist eine wilde Mischung aus Agententhriller und Klimaroman: Hauptfigur ist Sadie Smith, die von der CIA gefeuert wurde und nun ihre James Bond-Skills auf dem freien Markt anbietet. Ihr jüngster Undercover-Einsatz führt sie in das ländliche Südwestfrankreich, wo seit Jahren ein bitterer Kampf ums Wasser geführt wird. Ohne zu wissen, wer genau sie engagiert hat, soll Smith dort eine Gruppe von Klimaaktivisten infiltrieren, die verdächtigt wird den Bau eines riesigen Bassins sabotiert zu haben, das der Wasserversorgung der industriellen Landwirtschaft dienen soll. Smiths Auftrag lautet, die höchst angespannte Situation gewaltsam eskalieren zu lassen, um möglichst viele der Aktivisten möglichst lange hinter Gitter zu bringen. Die skrupellose Smith blickt mit Spott und Verachtung auf das antikapitalistische Aussteigerleben der Kommune, allen voran auf Theorien ihres Gurus, demzufolge der Neandertaler der bessere Mensch und der Homo Sapiens die Wurzel allen Übels sei - bis sie bemerkt, dass sie dem allen durchaus etwas abgewinnen kann.
Mehr dazu auf topos.orf.at
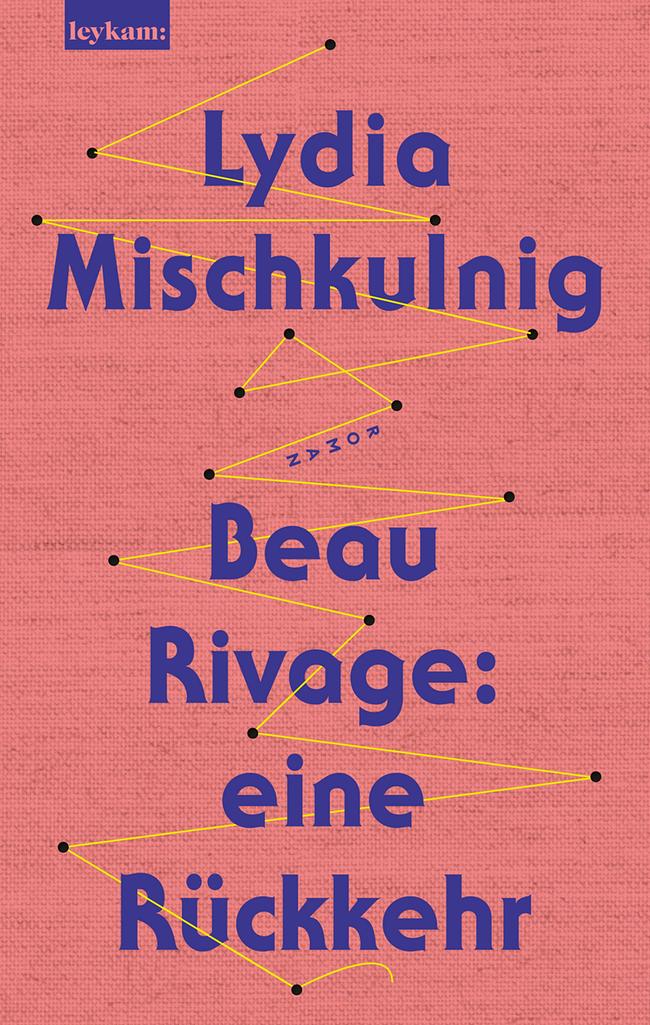
8. Lydia Mischkulnig (13 Punkte) NEU
„Beau Rivage: eine Rückkehr“, leykam
Lydia Mischkulnig zählt zu den markanten politischen Stimmen der Gegenwartsliteratur. In ihrem neuen Roman „Beau Rivage. Eine Rückkehr“ folgt sie Karl, einem Delegierten des Roten Kreuzes, der nach einem Einsatz in Afghanistan in die scheinbare Ruhe der Schweiz zurückkehrt – genauer: in das mondäne Hotel Beau Rivage am Genfersee. Was wie ein Rückzug in Sicherheit wirkt, entpuppt sich bald als Konfrontation mit inneren und gesellschaftlichen Spannungen. Lydia Mischkulnig erzählt mit klarem Blick und hoher sprachlicher Präzision. Ihr Roman beleuchtet die unsichtbaren Grenzen zwischen Mitgefühl und Gleichgültigkeit, zwischen Wohlstand und Verantwortung. Wie geht eine saturierte Gesellschaft mit jenen um, die alles verloren haben? Was bleibt von der Idee der Humanität, wenn sie auf den Prüfstand realer Biografien trifft? Ohne einfache Urteile, aber mit klarem politischem Bewusstsein legt Mischkulnig die Widersprüche westlicher Lebensrealitäten offen. „Beau Rivage. Eine Rückkehr“ ist ein vielschichtiger, aufrüttelnder Roman.
Mehr dazu auf on.orf.at
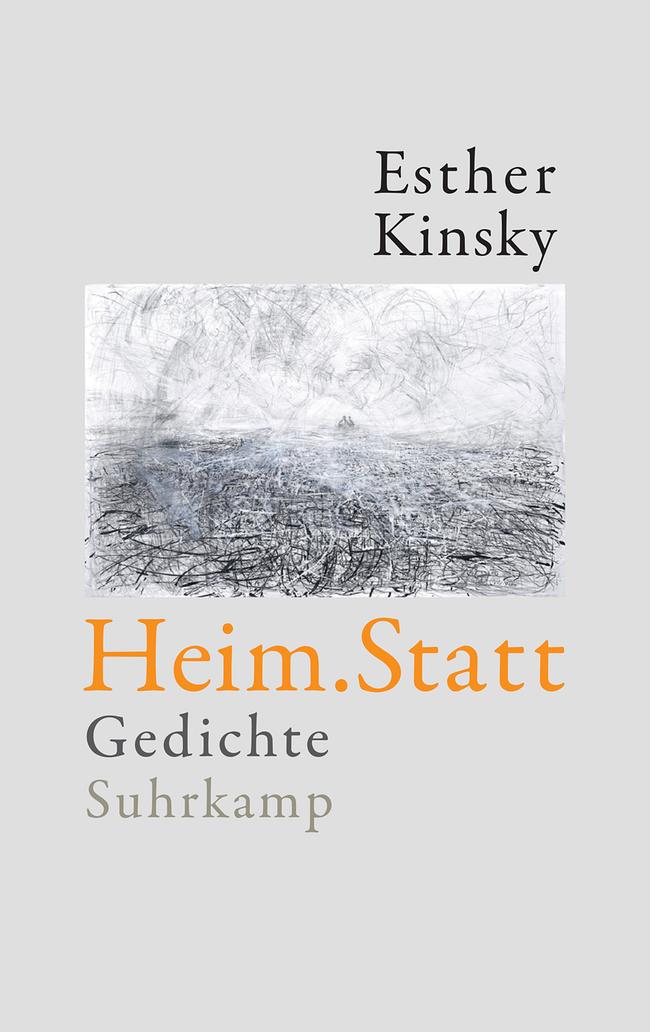
9. Esther Kinsky (12 Punkte) NEU
„Heim.Statt“, Suhrkamp
Die Peripherien dieser Welt, sie prägen das Werk der Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinsky. In ihren zahlreichen Romanen, Essays und Gedichtbänden rückt sie dasjenige ins Zentrum, was an den äußersten Rändern unserer Wahrnehmung sein Dasein fristet. Oft steht dabei die Natur im Fokus, die bei Kinsky jedoch nicht als idyllischer Rückzugsort oder Gegenpol zum menschlichen Alltag verstanden wird, sondern als mit dem Menschen auf tiefste verbundener Lebensraum. Das gilt auch für ihren Gedichtband „Heim.Statt“. In insgesamt sieben Langgedichten wird die Natur hier zwar in ihrer ganzen Schönheit lautmalerisch heraufbeschworen, gleichzeitig bleibt sie stets auch Schauplatz menschlicher Tragödien. Verankert zwischen Antike und Gegenwart, Mythos und Realität, kreisen Kinskys Gedichte um Flucht, Vertreibung und Abwanderung – und folgen der Balkanroute vom historischen Thrakien bis ins heutige Serbien.
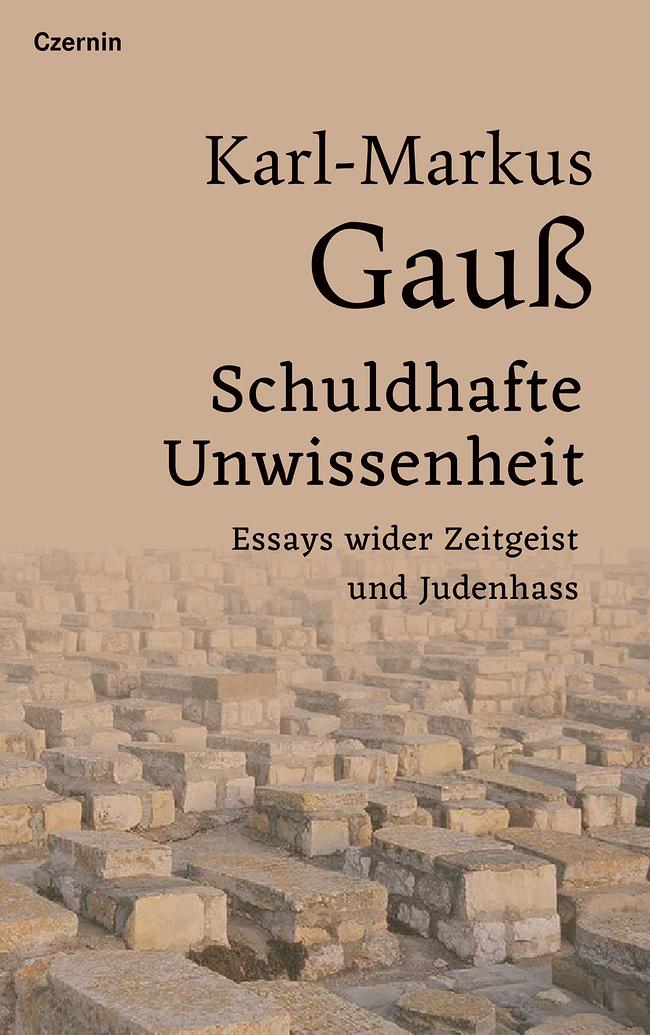
10. ex aequo: Karl-Markus Gauß (11 Punkte)
„Schuldhafte Unwissenheit“, Czernin
Der österreichische Schriftsteller und Publizist Karl-Markus Gauß hat sich in den letzten Jahrzehnten ein großes Publikum und viel Renommee erschrieben: er kennt die Minderheiten Europas wie kein anderer, hat sich stets auch mit jüdischer Kultur und Geschichte beschäftigt. In seinem jüngsten Buch steht die Auseinandersetzung mit dem grassierenden Antisemitismus im Zentrum. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7.Oktober 2023 ist dieser weltweit massiv gestiegen, auch hierzulande. In „Schuldhafte Unwissenheit“ geht Karl-Markus Gauß den Ursachen nach und stellt die These auf, dass nichts so sehr den Hass anstachelt, wie der Anblick jüdischer Opfer. Mit den pro-palästinensischen Protesten auf unterschiedlichsten Universitäten weltweit geht Karl-Markus Gauß hart ins Gericht: dabei betont er, dass er die Kritik an der gegenwärtigen rechtsreligiösen israelischen Regierung, ihrer Politik und ihrem Vorgehen für richtig und wichtig hält; darüber hinaus: dass er die Hamas nicht mit der palästinensischen Bevölkerung gleichsetzt. „Schuldhafte Unwissenheit“ ist ein zorniges Buch, zugleich eines, das uns leidenschaftlich dazu auffordert, zu differenzieren statt zu simplifizieren.
Mehr dazu auf oe1.orf.at
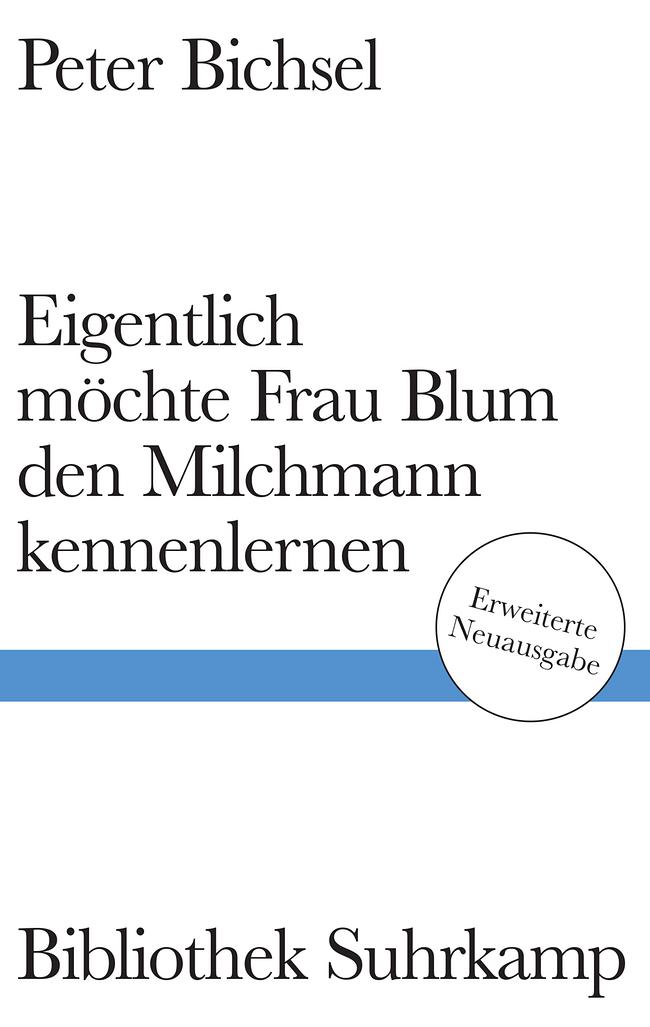
10. ex aequo: Peter Bichsel (11 Punkte)
„Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen“, Bibliothek Suhrkamp
Herausgegeber: Andreas Mauz und Beat Mazenauer
In der Schweiz zählt der kürzlich verstorbene Peter Bichsel zu den literarischen Aushängeschildern des Landes. Dass er trotz zahlreicher Veröffentlichungen und Auszeichnungen nie den Popularitätsgrad eines Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt erreichte, mag damit zusammenhängen, dass sich Bichsel nicht auf Romane, sondern auf Kurz- und Kürzestgeschichten spezialisiert hat. Ähnlich wie Ilse Aichinger, oder auch seine Landsfrau Adelheid Duvanel, setzte Bichsel in seinem Schreiben stets auf sprachliche Verdichtung und Verknappung. So auch in seinem Erstling „Eigentlich wollte Frau Blum den Milchmann kennenlernen“. Der 1964 erschienene Erzählband machte Peter Bichsel damals schlagartig bekannt, anlässlich von Bichsels 90. Geburtstag wurde das Buch neu aufgelegt. In insgesamt 21 Erzählungen schildert Bichsel darin den menschlichen Alltag, erzählt lakonisch von scheinbar Nebensächlichem wie dem Einbruch des Winters, dem Kartenspiel im Gasthaus oder den Facetten des Beamtenlebens. Mit subtilem Humor und großer sprachlicher Beobachtungsgabe hat Bichsel darin Figuren geschaffen, die einem augenblicklich nahe gehen, obwohl man kaum mehr als ein paar Sätze über sie erfährt.
Mehr dazu auf oe1.orf.at