Marko Dinić
Der neue Roman von Marko Dinić ist wie ein Wimmelbild – so viele Figuren, so viele Gesichter! Langsam und konzentriert muss man ihn lesen, sonst geht man darin verloren. Nimmt man sich aber Zeit für dieses „Buch der Gesichter“, so wird man überreich belohnt, denn Marko Dinić verfügt über eine Fähigkeit der Beschreibung, die immer wieder staunen macht. Wenn er Figuren und Gesichter zeichnet, greift er nie in den Topf vorgefertigter Redewendungen, und so erfährt man Situationen, die man auch anderswo schon gelesen hat, noch einmal völlig neu. „Von einem Einschlag zum nächsten … wurden seine Sinne geschärft am Wetzstein der Angst, die aus allem ein Überleben machte“, liest man da. Oder: „In einem solchen Gemenge aus enttäuschter Trunkenheit, deutscher Besatzung und jederzeit möglichem Denunziantentum gerann die Zeit zu Sekundenklumpen, die, zusammengezählt, keine Minuten ergaben.“
Die deutsche Besatzung von Belgrad im Zweiten Weltkrieg nimmt einen großen Platz ein, denn die acht Kapitel des Romans kreisen um jenen Tag im Jahr 1942, an dem die Stadt für „judenfrei“ erklärt wurde. Sie greifen zurück bis an das Ende des 19. Jahrhunderts und den Ersten Weltkrieg, deuten voraus bis zu den Jugoslawienkriegen und erzählen dieselben Ereignisse aus einer je anderen Perspektive. Dabei entsteht fast eine Enzyklopädie des jüdischen Lebens in Ex-Jugoslawien, und es nötigt einem großen Respekt ab, was Marko Dinić da alles recherchiert und auf wie viele Details er sich eingelassen hat. Deswegen braucht der Roman auch ein Glossar, zumal er oft auf südslawische Termini zurückgreift.
Dennoch verströmt das „Buch der Gesichter“ nie einen Hauch von Gelehrsamkeit, denn seine Erzähl-Kamera ist immer auf konkrete Menschen und Mikro-Situationen ihres Alltags gerichtet. „Mein Ziel war es nicht, einen historischen Roman zu schreiben, sondern zu versuchen, eine historische Zeit fernab der ‚großen Geschichte‘ erfahrbar zu machen“, sagt der Autor in einem Interview des Verlags, und das ist ihm hervorragend gelungen. Im Mittelpunkt steht Isak Ras, der zum Schutz vor den Nazis zu Ivan mutiert und immer auf der Suche nach Fragmenten seiner Identität ist – er ist ein angenommenes Kind, und eines Tages verschwindet auch seine Ziehmutter Olga.
Marko Dinić spricht von einer „generation-after novel“, er schreibt bewusst als Nachgeborener in einer Zeit, in der die letzten Zeuginnen und Zeugen der Shoah sterben. Und er hat Serbien im Fokus – das Land, in dem er seine Kindheit und Jugend verbracht hat. In der österreichischen Literatur schließt er damit vor allem an die Zeitzeugen Ivan Ivanji und Milo Dor an; Letzterer hat mit seinem grandiosen Roman „Tote auf Urlaub“ einen Auftritt im „Buch der Gesichter“. Es hält Österreich einen sehr kritischen Spiegel vor: Österreicher erweisen sich nicht nur als „schlimmste Deutsche“ während der NS-Okkupation, die k. u. k. Armee hat auch Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg begangen. Der Roman enthält so viele wichtige historische Details, doch ein Kunstwerk ist er durch seine Sprache, die zugleich Träume und Tagträume farbig auszumalen imstande ist.
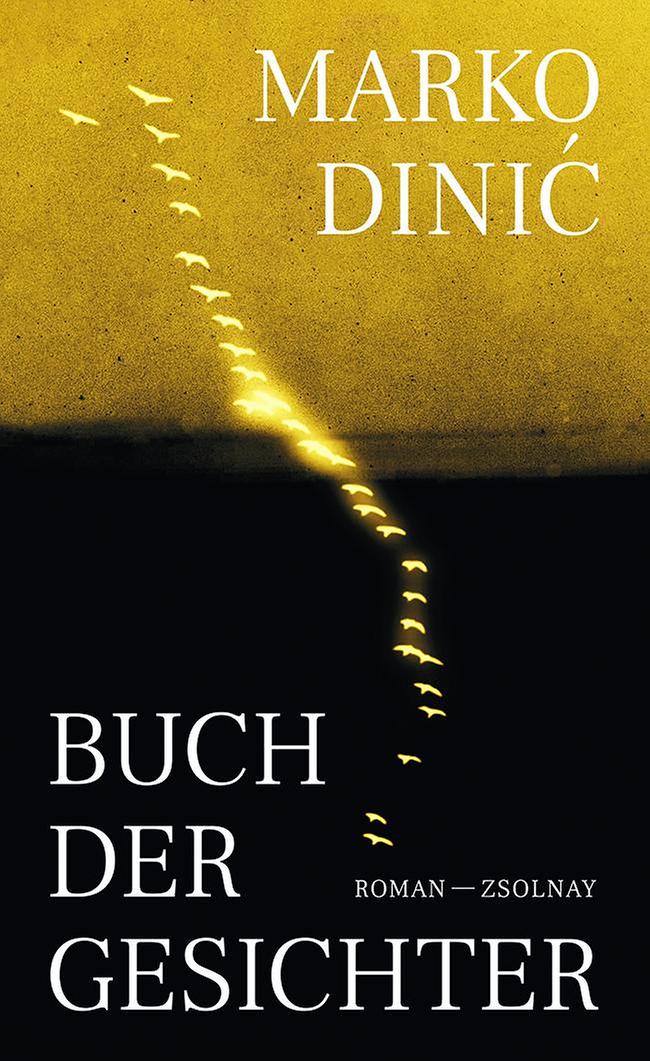
Buchinfo: Marko Dinić: „Buch der Gesichter“
Erscheinungsdatum: 19.08.2025
Zsolnay
Das „Buch der Gesichter“ hätte nur eines gebraucht: ein gutes Lektorat. Ein Autor, der sich so virtuos auf unkonventionelle Beschreibungen versteht, kann sich dabei auch einmal vergreifen. „Daneben zerfiel ein Stillleben aus Viehkarren, Schnapsfass und Scheune zu Trübsinn“ wäre ein genialer Satz – aber wenn dieses Stillleben auch noch „sorgfältig“ zerfällt? Oder kann einem etwas „sonderlich egal“ sein? Und was soll „einen Augenwurf entfernt“ bedeuten? Dazu gibt es leider Sätze mit falscher Wortstellung. Ärgerlich ist die wahllose Mischung von Austriazismen und typisch bundesdeutschen Ausdrücken. Man kann nicht im selben Text von einem „Ahnl“ oder einem „Sandler“ sprechen und dann „Kneipe“, „Rote Beete“ oder „einen Kanten Brot“ verwenden. Noch irritierender ist die wahllose Mischung von Stilebenen. Um die Redeweise einer früheren Zeit abzubilden, werden gelegentlich erlesene alte Wörter wie „ansichtig werden“ oder „abominabel“ verwendet – das kann man aber nicht mischen mit Ausdrücken wie der „Denke“ oder der „Fresse“ eines Menschen, dem „Herumwuseln“ von Kühen oder mit Sätzen wie „Der Feind ist gefühlt überall“. Und wenn dann noch mehrmals etwas im heutigen Jugendjargon als „krass“ bezeichnet wird … Außerdem ist bei den nicht wenigen ungarischen Namen die richtige Schreibweise offensichtlich nur ein Zufallstreffer, denn oft geht das schief (und das im Verlag, der einen ungarischen Namen hat). Natürlich ist ein so großer, ja einzigartiger Roman wie „Buch der Gesichter“ durch solche vom Verlag unbemerkte Malheurs nicht kaputt zu kriegen, doch beschädigt ist er allemal.
Einzigartig ist der Roman nicht nur durch seine Beschreibungskunst und die kreative Verschränkung von Fakten und Fiktion, sondern vor allem auch durch seine Multiperspektivität, die so viele Überraschungen birgt. Geradezu bewundernswert ist, wie Marko Dinić ein Dokument seiner Familiengeschichte – einen Brief seines 1993 im Bosnienkrieg umgekommenen Onkels – integriert und damit alles noch einmal in einem neuen Licht erscheinen lässt.
Das Außerordentlichste und Verwunderlichste an den acht Schneisen, die in die Romanhandlung geschlagen werden, ist vielleicht, dass ein Kapitel aus der Perspektive einer Hündin erzählt wird. Die Spur ihres Lebens führt bis nach Wien, und ihre Erzählung wird schon deswegen nie unfreiwillig komisch, weil ironisch bewusst gemacht wird, dass ja doch ein Mensch aus der Perspektive eines Tieres erzählt; und weil die tragische Geschichte der Hündin Malka so vieles mittransportiert, was weit über sie hinausgeht. Wahrscheinlich wurde seit dem 1956 erschienenen „Niki oder Die Geschichte eines Hundes“ von Tibor Déry kein Roman mehr geschrieben, der Menschen so überzeugend aus der Perspektive einer Hündin darzustellen weiß.
Viele menschliche Gesichter zeichnet dieser Roman, doch seinen Titel hat er von einer Prachtausgabe der Hagada, dem jüdischen Gebetbuch zum Pessachfest; Isaks Ziehbruder Petar stellte sie sich „als ein Buch der vielen Gesichter und Geschichten vor, die dem Gesicht und der Geschichte seines Bruders ähnelten“. Dieses kostbare Buch ist das verborgene Zentrum des ganzen Romans, und am Ende wird es durch Schüsse zerfetzt. Marko Dinić ist ein großartiges Panorama gelungen, das bis in die Gegenwart reicht. Zu Recht wurde „Buch der Gesichter“ für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Text: Cornelius Hell, Die Presse