
Bewusst Gesund - Das Magazin
Chronischer Tinnitus – was tun gegen den Lärm im Ohr?
Tinnitus – häufig als ein Klingeln, Rauschen oder Pfeifen im Ohr beschrieben, ist weit verbreitet. In Österreich ist etwa jede achte Person davon betroffen. Dabei handelt es sich um ein Symptom, das auf eine Fehlfunktion, Überlastung oder Erkrankung im Ohr hinweisen und viele Ursachen haben kann. Bei den Betroffenen sorgen die Ohrgeräusche oft für einen großen Leidensdruck - vor allem, wenn sie chronisch werden. Zur Behandlung von Tinnitus werden derzeit unter anderem die Tinnitus-Retraining-Therapie sowie die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) erfolgreich eingesetzt. Erstere zielt darauf ab, den Tinnitus durch den Einsatz von Rauschgeneratoren (Noisern) in den Hintergrund zu drängen. Bei Personen mit Hörminderung werden auch Kombinationsgeräte (Hörgeräte mit integriertem Noiser) verwendet. Ergänzend dazu kann die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) helfen, negative und belastende Gedankenmuster zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, das Leben mit dem Tinnitus zu erleichtern.
Gestaltung: Marie-Christine Kollos
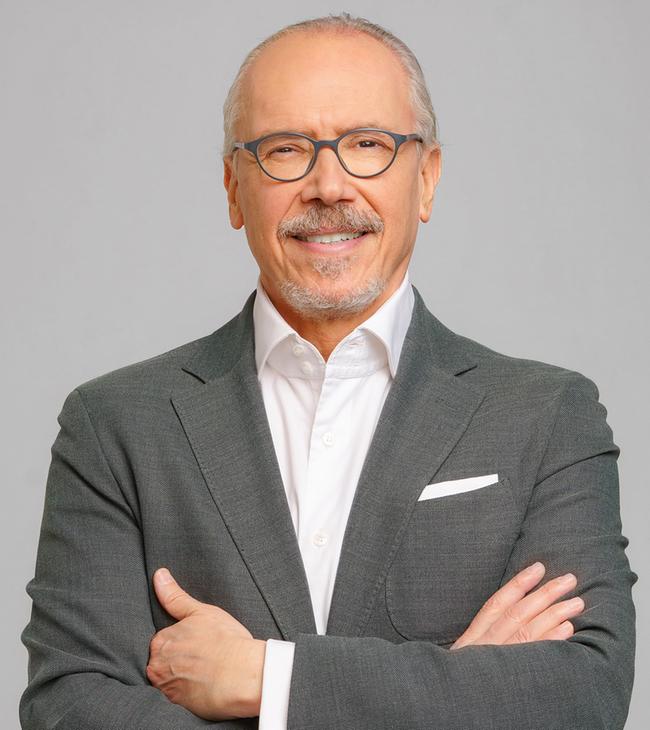
BG-Tipp: Hörsturz
Vor der Entwicklung eines Tinnitus steht oft ein Hörsturz. Das ist ein plötzlicher, meistens einseitiger Hörverlust ohne erkennbare Ursache. Er kann von einer geringen Hörminderung auf einem Ohr bis zur völligen Gehörlosigkeit reichen. Oft bilden sich die Symptome spontan wieder zurück, jedoch nicht immer. Der Verlauf des Hörsturzes ist sehr unterschiedlich. Betroffene schildern zum Teil auch ein Druckgefühl oder ein Gefühl wie „Watte“ im Ohr. Dazu können weitere Symptome wie Schwindel oder Ohrgeräusche (Tinnitus) kommen. Die genaue Ursache eines Hörsturzes ist noch unklar. Vermutet wird jedoch, dass unter anderem Durchblutungsstörungen, Entzündungen im Ohr oder extreme Stresssituationen eine Rolle spielen könnten. Wie man sich verhalten soll, wenn solche Symptome auftreten, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.
Aus der geschützten Werkstätte in den Ruhestand – Fehlanzeige!?
Mehr als 25.000 Menschen mit Behinderung arbeiten in Österreich in so genannten Tageswerkstätten. Sie erhalten für diese Arbeit nur ein geringes Taschengeld und sind unter anderem nicht pensionsversichert. Dass Menschen mit Behinderung in Altersteilzeit oder Pension gehen können, war bisher nicht vorgesehen - obwohl auch hier die Lebenserwartung dank des medizinischen Fortschritts im Schnitt stark gestiegen ist. Erst im vergangenen Jahr wurden diese gravierenden Missstände bezüglich Inklusion aufgedeckt. Seither bietet nur die Steiermark als einziges Bundesland in Österreich ein entsprechendes Modell an, um die Lebensqualität Betroffener zu sichern und ihnen auch im Alter ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die Einrichtung LebensGroß Steiermark hat die Neuregelung trotz des erhöhten Betreuungsaufwands bereits erfolgreich umgesetzt. Bewohnerinnen und Bewohner über 65 Jahre können dort ihren Ruhestand genießen. Eine Entwicklung, die sowohl von den Betroffenen als auch vom Pflegepersonal positiv aufgenommen wird.
Gestaltung: Daniel Thalhamer
Gespräch: Pensionierung für Menschen mit Behinderung
Seit 2008 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich in Kraft. Dennoch hinkt das Land bei der Inklusion in der Arbeitswelt im internationalen Vergleich weit hinterher. Nur in der Steiermark haben Menschen mit Behinderung, die in Tageswerkstätten arbeiten, im Rahmen eines Modells seit kurzem die Möglichkeit, in Pension zu gehen. In geschützten Werkstätten werden Produkte produziert oder wichtige Vorarbeiten geleistet: Zum Beispiel werden Vorhänge für eine große Möbelfirma genäht oder Designermode bestickt. Zusätzlich hat die Schlechterstellung auch negative Folgen für das Leben im Alter. Denn, für den normalen Arbeitsmarkt als arbeitsunfähig eingestufte Menschen mit Behinderung haben bisher in acht Bundesländern keinen Anspruch auf Pension. Die Begründung lautet: Es gibt tagsüber keine anderen Betreuungsmöglichkeiten. Deshalb arbeiten die Menschen teilweise auch noch mit weit über 70 Jahren, erklärt ein Experte der Behinderten-Anwaltschaft im „Bewusst gesund“ Studio.
Butter versus Pflanzenöle
Kann Butter – wie es einst ein Werbespruch behauptete – wirklich durch nichts ersetzt werden? Eine der größten Metastudien zu diesem Thema - d.h. eine Studie, die die Daten mehrerer Studien zusammenfasst - mit insgesamt mehr als 220.000 Teilnehmer*innen und einer Laufzeit von 30 Jahren kommt aktuell zu einem anderen Ergebnis. Das Sterberisiko jener Proband*innen, die besonders viel Butter verwendeten und nur wenig Pflanzenöle, war demnach um mehr als 15 Prozent höher als bei jenen, die umgekehrt keine oder nur wenig Butter konsumierten, dafür aber viele pflanzlichen Fette und Öle. Viele Ernährungsexpertinnen raten daher, tierische Fette aus Butter oder Schmalz vermehrt durch solche aus pflanzlichen Ausgangsstoffen zu ersetzen. Wobei es auch bei der Butter nicht nur auf die Menge, sondern auf die Qualität ankommt. Stichwort: Weidehaltung - die sich auf die Zusammensetzung der Fette in der Butter auswirken können.
Gestaltung: Christian Kugler

Moderation: Dr. Christine Reiler
weitere Informationen
Bei Fragen zur Sendung oder einem Anliegen, senden Sie uns bitte ein E-Mail.
bewusstgesund@orf.at
Die Sendung BEWUSST GESUND ist in Gebärdensprache auf ORF 2 Europe zu sehen und über Digitalsatellit oder in Kabelnetzen, in denen ORF 2 Europe eingespeist ist.