Durchs wilde Wokestan
Der gefeierte Gert Voss als „Othello“, die Ikone der Frauenbewegung Frida Kahlo als Indigene, Oscarpreisträger Marlon Brando als japanischer Hausjunge, Comedy-King Bully Herbig als „Winnetouch“ und „Abahachi“ oder die brillante Helen Mirren gar als israelische Ministerpräsidentin Golda Meir. „OMG“ – ein vehementer Aufschrei würde durch die globale Community der Wokisten und der Politisch Korrekten gehen, dürften doch nach deren Meinung nur Schwarze Schwarze darstellen, Juden nur Juden, Indigene nur Indigene, Homosexuelle nur Homosexuelle. Es ist der Kampfbegriff unserer Tage: spätestens seit #MeToo, #OscarsSoWhite und der Black Lives Matter Bewegung kocht die Woke-Debatte auch in Europas Kulturbranche hoch.
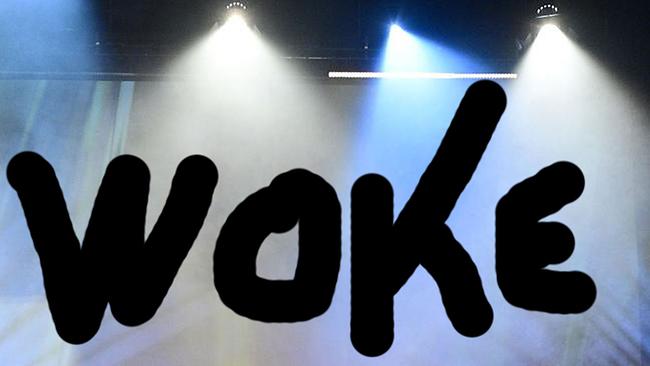
Ob Winnetou oder Layla, blackfacing oder whitewashing im Film wie auf den Bühnen, das böse N-Wort oder I-Wort in Literatur-Klassikern – Wokeness, also Wachheit und Wachsamkeit scheint die political correctness als Feindbild konservativer Kulturkämpfer abgelöst zu haben. Die Frage nach der Moral in der Kunst ist laut geworden. Im gesellschaftlichen Diskurs heizt die jüngere Generation der älteren ordentlich ein, will man sich doch für den Schutz von Minderheiten einsetzen und sensibel für Diskriminierung sein.

Treibt das identitätspolitische Aufbegehren einen Keil in die Gesellschaft? Führt die kulturelle Aneignung zu einer anhaltenden Marginalisierung von Schwarzen, von PoCs oder Indigenen oder hat die Kunst immer schon vom Austausch zwischen den Kulturen gelebt? Bleibt die vielgerühmte Freiheit der Kunst dabei auf der Strecke? Wie weit darf die kulturelle Freiheit gehen und wo sind die Grenzen des moralisch Erlaubten? Braucht unsere Gesellschaft gar ein neues kulturelles Benimm-Büchlein?
TV-Beitrag: Eva Maria Kaiser & Allegra Mercedes Pirker