
Die Beste im Dezember 2023: Zadie Smith
Die britische Autorin Zadie Smith hat immer beteuert, dass sie die Erzählform des historischen Romans nicht leiden kann. Seit ihrem Debütroman von 2000, dem Weltbestseller „Zähne zeigen“, hat sich die Tochter eines weißen britischen Vaters und einer jamaikanischen Mutter mit ihren Erzählstoffen immer entschieden an die Gegenwart und deren multiethnische Probleme gehalten.
Doch jetzt, wo sie auf die 50 zugeht, hat Zadie Smith erkannt, dass gelungene historische Romane aus heutiger Perspektive geschrieben sind und dadurch unsere Sicht auf Vergangenheit und Gegenwart verändern können. Smiths eben erschienener sechster Roman „Betrug“ ist ein waschechter historischer Roman: Er erzählt im Lichte heutiger Erfahrungen mit Fake News und alternativen Fakten von Betrug, Täuschungen und Selbsttäuschungen im Viktorianischen Zeitalter sowie von der problematischen Rolle der Literatur und der Sklaverei bei der Ausformung des Narrativs über das britische Empire.
„Betrug“ ist ein Puzzle aus fast 200 Kurzkapiteln, die temperamentvoll durch das Viktorianische Zeitalter hüpfen. Der Roman kreist um einen bizarren Londoner Sensationsprozess, der in den 1870er-Jahren das Land aufwühlte und polarisierte – das Volk gegen das Establishment. Smith macht den „Fall Tichborne“ zum Modell, an dem sich die Widersprüche der Klassengesellschaft im viktorianischen England auf dem Höhepunkt seiner imperialen Machtausdehnung demonstrieren lassen. Im Mittelpunkt steht die Suche nach Wahrheit im Fall eines Hochstaplers.
Ein Londoner Metzger, der vor seinen Schulden nach Australien geflüchtet war, behauptete, er sei Sir Roger Tichborne, der 1854 auf See verschollene Erbe einer reichen englischen Adelsfamilie. Er habe den Schiffsuntergang vor zwölf Jahren überlebt und sich nach Australien gerettet. Jetzt sei er nach England zurückgekehrt, um sein Erbe einzuklagen.
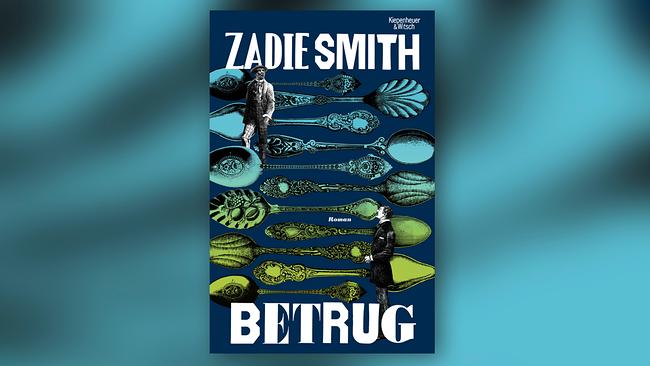
Der Mann war offensichtlich ein Betrüger. Er sah dem echten Sir Roger nicht ähnlich, konnte sich an keinen seiner angeblichen Schulkameraden erinnern und auch nicht an Details seiner Familiengeschichte und seines Bildungswegs. Er sprach das Londoner Unterschichtidiom Cockney, konnte aber kein Wort Französisch, obwohl dies die Muttersprache des echten Sir Roger gewesen war. Dennoch bestätigten zwei Personen seine Identität. Lady Tichborne, die Mutter des Verschollenen, und Bogle, der kreolische Hausdiener auf der Plantage der Tichbornes in Jamaika, wollten in dem Schwindler den echten Sir Roger wiedererkannt haben.
Der Fall zog sich über Jahre hin. Er bescherte den Zeitungen saftige Storys und dem falschen Sir Roger die Gefolgschaft von Tausenden fanatischen Anhängern, die seinen Lügen und den abstrusen Auftritten seines exzentrischen Anwalts glaubten, seinen Spendenaufrufen nachkamen und im Prozess eine Verschwörung der Eliten erblickten, die einen Mann aus dem Volke um seine gerechten Ansprüche betrügen wollten. Parallelen zur Gegenwart liegen auf der Hand.
Der falsche Tichborne ist nicht der einzige Betrüger in Zadie Smiths Roman. Es wimmelt darin von Schwindlern und Scharlatanen unterschiedlicher Couleur. Einer davon ist der einst erfolgreiche, inzwischen vergessene viktorianische Schriftsteller William Ainsworth, Verfasser von mehr als vierzig historischen Romanen. Er ist die erbärmlichste Figur im Buch.
Anfangs können sich seine Verkaufszahlen noch mit denen von Charles Dickens messen, doch bald gelten seine schwülstigen historischen Romanzen als Ladenhüter. Er wird zur Zielscheibe des Spotts seiner erfolgreichen Autorenkollegen Dickens, Thackeray und Edgar Allan Poe, die ihn als literarischen Falschmünzer verachten. Die paradoxe Pointe: In der Gestalt dieses lächerlichen Vielschreibers stellt Zadie Smith das Genre des historischen Romans als solches bloß – im Format eines historischen Romans.
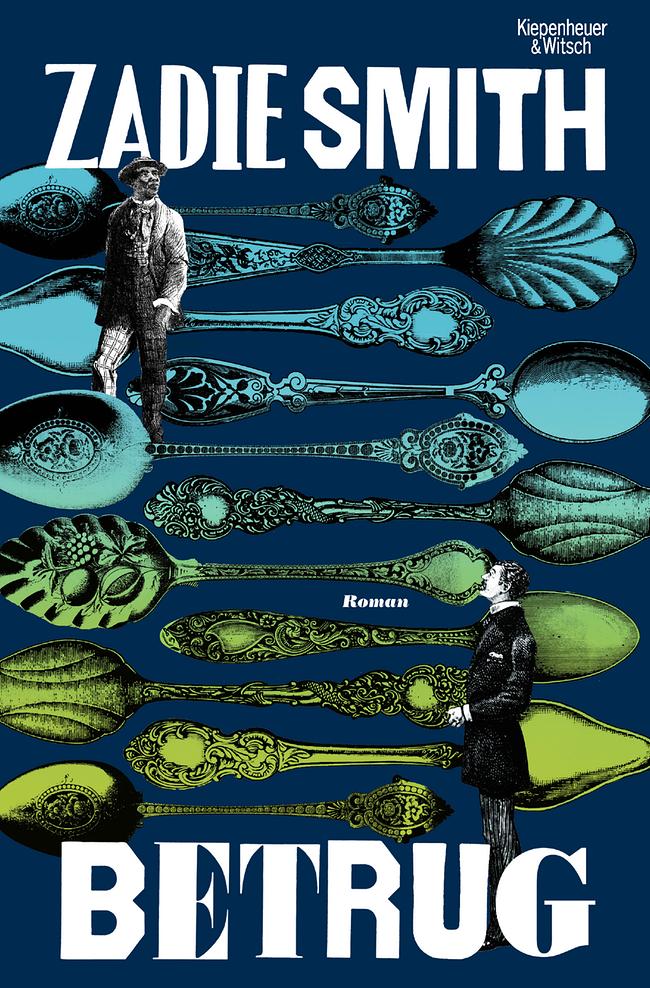
Zadie Smith: „Betrug“
Kiepenheuer & Witsch
Auch Charles Dickens, der größte viktorianische Autor, kommt schlecht weg. Smith zeichnet ihn als Vampir, den nicht Menschenliebe zu den Armen und Schwachen treibt, sondern einzig die Suche nach Material, das er klauen könnte. Auch er ist ein Betrüger, sein soziales Engagement ist Schauspielerei. Er beutet Eigenheiten und Sprechweise der Armen aus, um sie zur Unterhaltung der Mittelschicht in seinen Romanen zu karikieren.
Der Roman lebt von einem brillanten erzählerischen Kunstgriff Zadie Smiths. Sie betrachtet die Viktorianische Epoche durch die Augen einer originellen Perspektivfigur namens Eliza Touchet, die sich stellvertretend für die Autorin deren Gedanken machen darf über die damalige koloniale Welt und den Platz, der Frauen, Nichtweißen und Armen darin vorenthalten wird. Eliza ist die Cousine und zeitweilige Geliebte des Romanschreibers Ainsworth, führt ihm lebenslang den Haushalt, dient ihm als Faktotum und organisiert seine Saufeinladungen für seine literarischen Freundfeinde. Seine Romane findet sie unlesbar, „geschmacklos, gewalttätig, sensationslüstern und lachhaft“, ruft aber „Ein Triumph!“, wenn er ihr daraus vorliest.
Eliza ist das fünfte Rad an jedem Wagen. Dank ihres prekären Status und ihrer wachen sozialen Intelligenz steht sie im Leben zugleich drinnen wie draußen. Sie durchschaut die Betrügereien ihrer Mitmenschen und auch ihr eigenes Dilemma: Als ungesicherte ältere Frau mit wenig Geld ist sie darauf angewiesen, ihre dissidenten wahren Ansichten hinter Doppelzüngigkeit zu verbergen und ihre Umwelt permanent zu täuschen. Wenn sie ihre Existenz nicht gefährden will, kann sie weder ihre lesbische Sexualität noch ihren katholischen Glauben oder ihre Kritik am britischen Kolonialismus offenbaren.
Erst recht muss sie ihre literarischen Ambitionen geheim halten, denn sie schreibt an einem Roman über den Fall Tichborne. Ihr Hauptzeuge ist der jamaikanische Hausdiener Bogle, ein freigelassener Sklave, der Eliza sein Leben erzählt, als Roman im Roman, und ihr die Augen öffnet dafür, wie der Reichtum der feudalen englischen Oberschicht auf Sklaverei und kolonialer Ausbeutung beruhte. Doch Bogle bleibt ihr ein Rätsel. Warum hält er, ein kluger Mann, einen überführten Betrüger immer noch für den echten Sir Roger? Kann man aufrichtig falschliegen? Eliza erahnt in Bogle eine verwandte Seele: „Er lebte, wie sie es sich stets ersehnt hatte, ganz ohne Illusionen.“ Die Grundfrage Elizas und des Romans, das Problem der literarischen Wahrheit überhaupt, bleibt ungelöst: Was können wir je über andere wissen?
Text: Sigrid Löffler, Salzburger Nachrichten